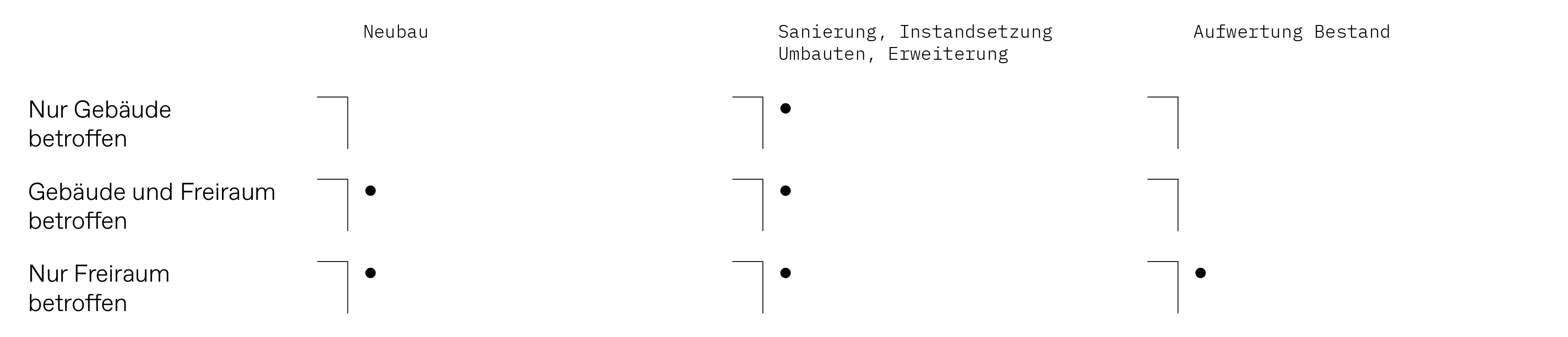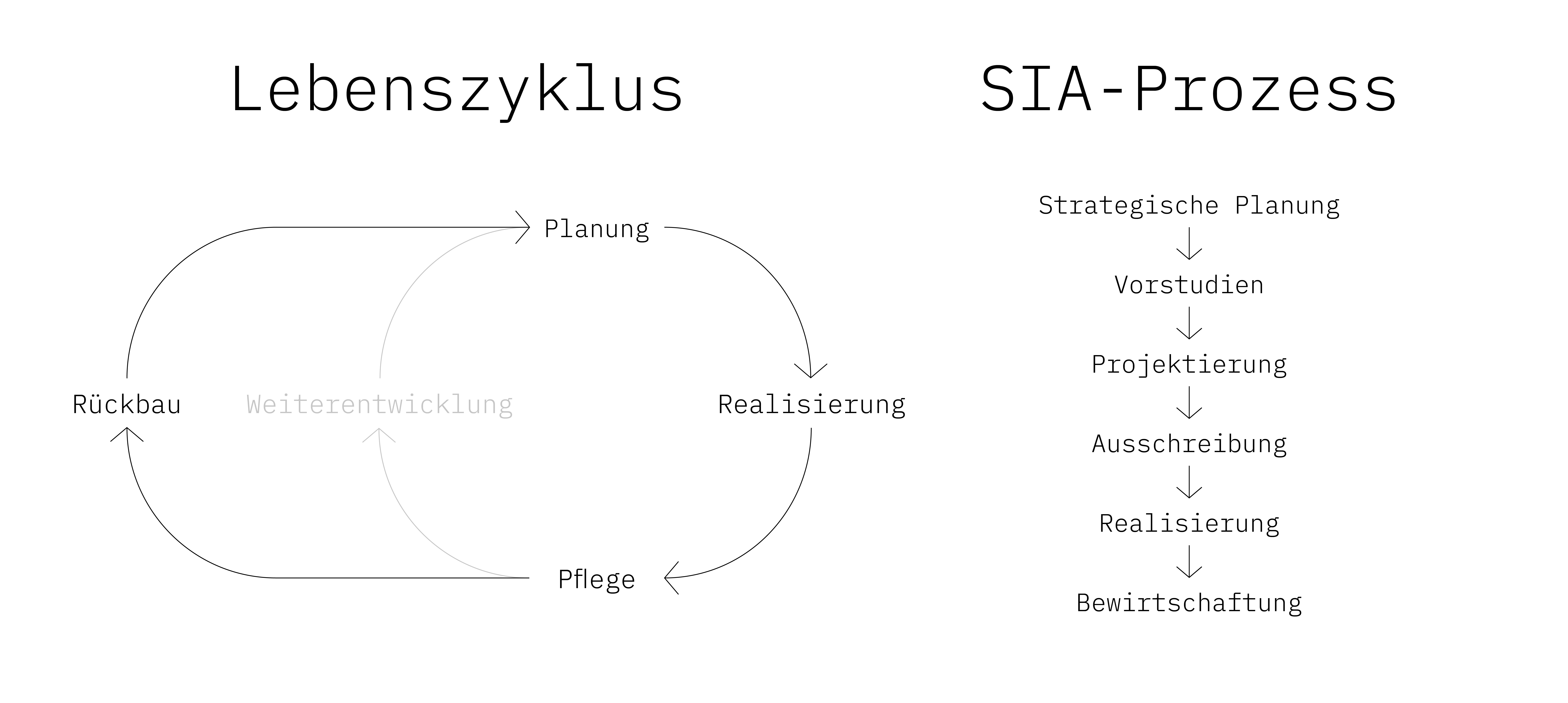In Kürze
In frühen Planungsphasen von Freiräumen werden die Weichen für eine erfolgreiche Biodiversitätsförderung gestellt.
Zentrales Element der Freiraumgestaltung ist es, ökologische, räumlich-ästhetische und soziale Aspekte zu berücksichtigen und dabei gleichzeitig ökonomische und technische Qualitäten sowie Prozessqualitäten zu beachten [1]. Diese breiten Anforderungen gilt es systematisch zu analysieren, zu erfassen und transparent zu kommunizieren, um darauf aufbauend Planungen zu entwickeln.
Im Rahmen des Planungsprozesses entstehen zwangsläufig Zielkonflikte. Die Planung, Gestaltung und Pflege von naturnahen Freiräumen bedeutet deshalb immer auch ein Abwägen unterschiedlicher Gesichtspunkte [1]. Der Entscheidungsweg sollte dabei für alle beteiligten Stellen durchschaubar und nachvollziehbar sein, weil früh im Prozess getroffene Entscheidungen weitreichende Folgen für die Zukunft und die Lebensdauer eines Grün- und Freiraums, insbesondere dessen ökologische und gestalterische Qualität, die Nutzungsmöglichkeiten und den langfristigen Unterhalt, haben.
Im Planungsprozess sollte zuerst geklärt werden, welcher Flächenanteil ökologisch wertvolle und naturnahe Lebensräume und Strukturen (z.B. im Sinne des ökologischen Ausgleichs) einnehmen können. In zahlreichen Gemeinden und Städten bestehen hierzu Auflagen. Im Rahmen der Umsetzung des ökologischen Ausgleichs wird dies noch wichtiger werden. In Folgeschritten sind die Massnahmen zur Biodiversitätsförderung in Gestaltungs- und Nutzungskonzepte zu integrieren.
Systematik
Der Planungs- und Umsetzungsprozess umfasst den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks – von der ersten Idee der Auftraggebenden, über die Planung und Realisierung bis zur langfristigen Pflege und dem Rückbau. Der Prozess wird von verschiedenen Akteuren beeinflusst [2]. Auch die Projektierung und Realisierung von Freiräumen folgt diesem Schema.
Grössere Projekte
Für grössere Projekte (z.B. Neubau von Wohnsiedlungen, Firmenareale) sind detaillierte Prozessschritte nötig. In der Schweiz wird der Planungs- und Bauprozess in der Verständigungsnorm zum Modell Bauplanung SIA 112 des Schweizerischen Architekten- und Ingenieursvereins (SIA) beschrieben. Ziel der Norm ist es, die Projektphasen und -ziele einheitlich zu definieren und so die Leistungen und Entscheide aller Beteiligten zu koordinieren [3].
Wohnbaugenossenschaft Oberfeld
Ostermundigen
Auf der Grundlage der Verständigungsnorm SIA 112 lässt sich ein für
ein erfolgreiches Projekt wichtiges, gemeinsames Verständnis der Prozesse
entwickeln. Im Folgenden sind daher die einzelnen SIA-Phasen mit ihren
zentralen Inhalten beschrieben. Der Fokus liegt dabei auf den
Massnahmen, die nötig sind, um die Biodiversität und naturnahe
Freiraumqualitäten in den einzelnen Projektphasen gezielt zu fördern.
Die Tätigkeiten der Landschaftsarchitekt:innen im Sinne der SIA 105
finden daher besondere Beachtung [4].
Eine umfassende Übersicht des allgemeinen Planungs- und Bauprozesses nach SIA 112 findet sich in der MAP – Methodische Anwendung zum Planungs- und Bauprozess, die durch die ETH Zürich entwickelt wurde [2].
Kleinere Projekte
Auch kleinere Projekte (z. B. Privatgärten, Umgestaltungen) und einzelne Fördermassnahmen sind relevant und für die Biodiversität wichtig. Es müssen nicht immer umfassende Grossprojekte sein. Die hier behandelten Massnahmen enthalten daher auch wertvolle Hinweise für die Biodiversitätsförderung in kleineren Projekten.
Unter-Grundhof
Wohnbaugenossenschaft WWL
Emmen
Ausgangslage
Unabhängig von der Projektgrösse gibt es im Planungs- und Umsetzungsprozess von Neuanlagen oder bestehenden Freiraumprojekten viele Gemeinsamkeiten aber auch einige Unterschiede. Gemeinsam ist, dass sich stets Chancen und Möglichkeiten für die Förderung von Biodiversitätsförderung und naturnahen Freiraumqualitäten bieten.
Gegenüberstellung von Projekttypen und ihrem Einfluss auf Gebäude und/oder Freiräume
Die vorgeschlagenen Massnahmen zur Biodiversitätsförderung auf fokus-n berücksichtigen sowohl Neubauten als auch Bauwerke und Freiräume im Bestand.
Neubau
Neuanlagen bieten die Chance, Grünraumprojekte von Anfang an auch hinsichtlich Biodiversitätsförderung zu optimieren und Naturnähe möglichst hoch zu gewichten. Ein Vorgehen entsprechend den beschriebenen Planungs- und Umsetzungsempfehlungen erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Neuanlage gut entwickelt und eine lange Nutzungsphase aufweist, was sie für die Biodiversität besonders wertvoll macht.
Umgestaltungen
Alte Grünstrukturen (z.B. Bäume, Blumenrasen) sind für die Biodiversität und viele Ökosystemleistungen von
grosser Bedeutung. Werden sie zerstört oder durch neue Strukturen
ersetzt, brauchen diese neuen Strukturen sehr lange, um dieselben
Leistungen erbringen zu können [5]. Umso wichtiger ist es, dass
bestehende Strukturen und Bestände im Rahmen von Umgestaltungen erhalten
bleiben und ihr ökologisches Potenzial (Biodiversität, Siedlungsklima,
Ressourcenschonung) erhöht wird.
Im Bestand können Anpassungen, Umbauten oder Erweiterungen aufgrund sich verändernden Anforderungen (z. B. Anspruchs- oder Nutzungsveränderung) notwendig werden. Solche Veränderungen können auch eine Chance bieten, um Aufwertungen in Richtung Biodiversitätsförderung vorzunehmen.
Lebenszyklus
Der Lebenszyklus von Freiräumen kann als Kreislauf aus Planung, Realisierung, Pflege und Rückbau dargestellt werden. Alternativ zum Rückbau können Freiräume auch weiterentwickelt werden. Nach diesem Schema sind auch die Massnahmen in den Fachthemen und Profilen dieser WebApp aufgebaut. Hinweise zur Weiterentwicklung werden an entsprechender Stelle gemacht.
Lebenszyklusphasen von Freiräumen
Wie bei Gebäuden ist es auch bei Freiräumen sinnvoll in Lebenszyklus-Phasen zu denken und die spezifischen Aufgaben der Grünraumentwicklung darin zu integrieren. Zwischen der Lebenszyklus-Betrachtung von Gebäuden und Freiräumen gibt es jedoch wesentliche Unterschiede.
Unterschied Gebäude und Freiraum
Bei Gebäuden handelt es sich um statische Elemente. Ihr Verfall beginnt nach der Realisierung. Durch Instandhaltungsmassnahmen, Umnutzungen, Umbau oder Teilerneuerungen kann dieser Prozess verzögert werden.
Im Vergleich dazu bestehen Grün- und Freiräume vorwiegend aus Vegetation und folglich aus dynamischen Elementen. Diese verändern sich permanent. Hier besteht die Möglichkeit einer Revitalisierung, welche im Lebenszyklus mehrmals wiederholt werden kann [1].
Grüner Freiraum in Zürich
Bildquelle: Daniela Kienzler
Bei Freiräumen spielt folglich die Lebenszyklus-Phase Pflege eine noch wesentlichere Rolle als bei Gebäuden.
Besonderheit Grünraumpflege
In Freiräumen manifestieren sich die eigentlichen Ziele und Bilder der Planung erst im Laufe der Zeit und zeigen sich nicht bereits nach der Realisierung.
Grün- und Freiräume müssen aber nicht nur umsichtig geplant, sondern auch fachlich korrekt realisiert und dabei die Pflanzen standortgerecht verwendet werden. Zudem müssen Grünräume langfristig fachlich korrekt gepflegt und unterhalten werden, damit sich Pflanzen so entwickeln, wie dies die Planung dereinst vorgesehen hat. Nur so können Grünräume im Laufe der Zeit ihre potenzielle Wirkung, Nutzen und Mehrwerte entfalten. Auch das Grundgerüst eines Grünraumes, die Pflanzen selber, sind einem Lebenszyklus unterworfen, der von der jeweiligen Pflanzenart abhängt. Das mögliche Lebensalter ist dabei arttypisch und stark abhängig von beispielsweise dem Standort, der Pflege oder den klimatischen Verhältnissen [1].
Weiterführende Informationen siehe Naturnahe Pflege.
Phasenaufbau SIA
Die Darstellungsform des Lebenszyklus als Kreislauf überschneidet sich mit den Planungs- und Umsetzungsphasen nach SIA 112, ist jedoch nicht deckungsgleich.
Die nachfolgende Grafik zeigt die Abstimmung der beiden unterschiedlichen Phasenmodelle. Im Folgenden findet jeweils die Gliederung nach SIA 112 Anwendung. Ziel dieses Aufbaus ist es, im Rahmen des etablierten SIA-Modells phasengerecht die für eine erfolgreiche Biodiversitätsförderung relevanten Massnahmen zu definieren. In den weiteren Artikeln dieser WebApp wird das vereinfachte Lebenszyklusmodell verwendet. Dies hat den Vorteil, dass auch kleinere Projekte leicht und der Rückbau als eigene Phase einbezogen werden können.
Vergleich SIA- und Lebenszyklus-Modell
Phase 1: Strategische Planung
-
Verankerung der Biodiversität als qualitative und quantitative Zielsetzung
-
Generelle Überlegungen zu Zielsetzungen verschiedener Akteure zur Biodiversitätsförderung und dazu, wie diese abgeholt werden könnten: Zielgruppenanalyse
-
Sicherstellung der personellen / fachlichen Verankerung durch Verpflichtung einer kompetenten Planungsperson von Beginn weg
-
Prüfung der Notwendigkeit eines Kommunikationskonzepts und von partizipativen Verfahren
Phasenbeschrieb
Inhalte gemäss SIA 112:
- Formulierung der Problemstellung, Bedürfnisse, Ziele und Rahmenbedingungen
- Festlegung einer Lösungsstrategie
Am Anfang eines Projekts steht eine Idee, die durch eine spezifische
Planung umzusetzen ist. Von der Definition der Ziele und Bedürfnisse,
über die Kosten bis hin zu Termine beinhaltet die Phase verschiedene
Themen.
Soll ein Projekt die Biodiversität fördern und naturnahe Freiraumqualitäten aufweisen, müssen diese Ansprüche bereits in der strategischen Planung gleichberechtigt einbezogen werden [7]. Hier werden wesentliche Weichen für eine naturnahe Gestaltung und Pflege von Freiräume gestellt und die finanziellen Mittel gesichert. Dabei gilt es, den ganzen Lebenszyklus zu betrachten [1].
Massnahmen im Detail
Ziele und Grundanforderungen festlegen
Zielvorgaben bezüglich Biodiversität, naturnahen Freiraumqualitäten und Nachhaltigkeit werden klar und verbindlich definiert. Von den Gemeinden gestellte Anforderungen (z.B. Flächenanteile, Saat- und Pflanzgut) werden berücksichtigt.
Biodiversität wird als integraler Bestandteil des Gesamtentwurfs geplant und das Potenzial von naturnahen und biodiversen Freiräumen wird aufgezeigt.
Die Förderung der Biodiversität wird durch qualitative und quantitative Grundanforderungen bzw. erhöhte Anforderungen (z.B. im Rahmen des ökologischen Ausgleichs) in die Bewertungskriterien zur Beurteilung verschiedener Lösungsstrategien einbezogen (siehe In Kürze).
Bei der Beschaffung der notwendigen Daten und Grundlagen werden die für eine standortgerechte Freiraumplanung relevanten gesetzlichen und planerischen Grundlagen sowie Vorgaben berücksichtigt (siehe Bestimmungen).
Zertifizierung planen
Wird eine Zertifizierung des Bauprojekts mit einem nachhaltigen Label angestrebt, ist dies in die Kosten- als auch die Terminübersicht einzubeziehen.
Personelle Anforderungen
Eine Fachperson Landschaftsarchitektur wird ab Projektbeginn in die Findung von Lösungsstrategien, die Planung und Realisierung des Freiraumes einbezogen. Diese Fachperson verfügt nachweislich über Kompetenzen in der Förderung von Biodiversität und naturnahen Freiräumen oder wird von entsprechenden Fachplanenden (z.B. Siedlungsökologie, Naturgarten) unterstützt.
Kommunikation und Partizipation
Durch Mitwirkungsverfahren können die Zielgruppen frühzeitig einbezogen, deren Bedürfnisse ermittelt und in die strategische Planung eingebracht werden.
Ein Kommunikationskonzept zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit wird erarbeitet und die wichtigsten Inhalte sind zielgruppengerecht aufbereitet. Ein Umsetzungsplan für das Kommunikationskonzept ist festgelegt.
Akteur:innen
- Bauherr:in
- Bauherrenvertreter:in
- Immobilienunternehmen
- Planungsteam
- Fachperson Landschaftsarchitektur
- Fachperson Ökologie und Biodiversitätsförderung
Phase 2: Vorstudien
-
Berücksichtigung naturräumlicher, historischer und planerischer Kontext
-
Berücksichtigung von Ansprüchen einheimischer Wildtiere und Pflanzenarten
-
Potenzial von partizipativen Prozessen nutzen
-
Optimierung Lebenszykluskosten
-
Erhalt bestehender ökologisch wertvoller Lebensräume und Schaffung neuer Strukturen
-
Erhalt und Schutz von gewachsenem Boden
-
Frühzeitige Berücksichtigung einer fachgerechten naturnahen Pflege
Phasenbeschrieb
Inhalte gemäss SIA 112:
- Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie
- Festlegung des Vorgehens und der Organisation, Definition der Projektierungsgrundlagen, Nachweis der Machbarbeit, Erstellung von Projektdefinition und -pflichtenheft
Sobald die Ziele der Auftraggebenden formuliert und die finanziellen sowie terminlichen Rahmenbedingungen geklärt sind, folgt die Phase Machbarkeit. In dieser Phase werden Ideen und Anliegen der direkt Betroffenen in eine Projektdefinition übersetzt und nach Lösungsmöglichkeiten gesucht.
Es werden die Potenziale des Orts (umfassende Analyse von ökologisch wertvollen Lebensräumen und Strukturen sowie Artvorkommen in der Umgebung) analysiert, in Ziele umformuliert und als konkrete Vorgaben in Programme und allenfalls Wettbewerbe integriert [7]. Die Wettbewerbsteilnehmer:innen setzen sich aus interdisziplinären Teams zusammen.
Anforderung an die Freiräume aus Sicht der Biodiversitätsförderung fliessen gezielt in die Lösungsfindung ein.
Hinweis: Wird ein anderes Verfahren gewählt (zum Beispiel Planerverfahren nach SIA 144) ändert sich hier das Vorgehen und die involvierten Akteur:innen. Siehe hierzu die entsprechenden Normen.
Massnahmen im Detail
Analyse des Standorts und der Umgebung
Bestehende Naturwerte werden erfasst und bewertet. Der Erhalt ökologisch wertvoller Lebensräume und/oder Arten wird für alle Folgephasen verbindlich geplant.
Grundlagen dafür sind Landschafts- und Biotopinventare gemäss NHG, Kantonale und kommunale Raumplanungs- und Bauvorschriften (Richt- und Nutzungsplanung), Sachspezifische Inventare und Karten in kommunalen (GIS-)Datenbanken, Landschaftsentwicklungskonzepte (LEK), Konzepte zur Arten- und Lebensraumförderung sowie Kommunale Leitbilder, Masterpläne, Agglomerationsprogramme, Grün- und Freiraumkonzepte.
Biodiversitäts- und Artenförderkonzept erstellen
Im Rahmen der Standortanalyse werden das Potenzial des Areals zur Biodiversitätsförderung sowie allfällige Einschränkungen für die Besiedlung durch Tiere und Pflanzen aufgezeigt. Mögliche Fallen und Hindernisse für Tiere werden berücksichtigt sowie vor Störungen geschützte Bereiche eingeplant (siehe Wildtiere im Siedlungsgebiet).
Leitarten festlegen
Floristische und faunistische Leitarten werden festgelegt, ihr potenzielles Vorkommen am Ort überprüft und entsprechende Fördermassnahmen für den gesamten Lebenszyklus entwickelt. Die Massnahmen werden in das Gestaltungs- und Nutzungskonzept integriert. Grundlagen hierfür bilden nationale, kantonale sowie kommunale Inventare und Erhebungen / Konzepte lokaler Naturschutzorganisationen.
Akteursanalyse
Allfällige Nutzungs-, Interessen- und Zielkonflikte werden in der Akteursanalyse ermittelt. Dies kann in Form von Mitwirkungsverfahren (partizipative Prozesse) stattfinden.
Lösungsansätze entwickeln
Bauten werden möglichst kompakt und flächensparend, Freiräume zusammenhängend und weitgehend frei von Überbauungen und Unterbauungen sowie mit einem möglichst hohen Anteil unversiegelter Flächen und naturnahen Profilen geplant.
Es werden Gestaltungslösungen zur Förderung der Biodiversität und naturnahen Freiraumqualitäten im Rahmen des Gesamtentwurfs entwickelt. Die Anpassungsfähigkeit an sich verändernde Bedingungen sowie der Rückbau werden von Anfang an berücksichtigt.
Pflege frühzeitig einplanen
Bei der Kostenermittlung und der Terminplanung werden Unterhalt und Pflege der Freiräume berücksichtigt (Lebenszykluskosten). Die gesetzten Pflegeziele und -qualitäten werden verbindlich im Projektpflichtenheft festgehalten.
Ebenso werden die Biodiversitätsziele des Gesamtprojekts verbindlich und für alle beteiligten Unternehmen und alle nachfolgenden Phasen festgelegt. Die Ausprägung der Grünflächen im gesamten Bauprojekt wird in Bezug auf Quantität und Qualität vorgeschrieben. In den Profilen und Fachthemen werden hierzu die wesentlichen Grundlagen zur Verfügung gestellt.
Erfolgskontrolle und Monitoring
Eine detaillierte Erfolgskontrolle der definierten Biodiversitätsziele wird konzipiert und budgetiert. Sie wird in den Pflichtenheften verbindlich festgehalten.
Auswahl- und Vergabeverfahren
Im Auswahlverfahren wird das Ziel einer biodiversen und naturnahen Gestaltung eingefordert und anhand der Projektdefinition und der Pflichtenhefte in Bezug auf Qualität und Quantität verbindlich vorgegeben.
Bei der Auswahl der Preisrichter:innen für das Vergabeverfahren werden qualifizierte Fachpersonen für die Bewertung der ökologischen Qualität und Biodiversität berücksichtigt.
Akteur:innen
- Bauherrenvertreter:in
- Wettbewerbsteilnehmer:innen
- Verfahrensbegleiter:in
- Preisrichter:innen
- Fachperson Landschaftsarchitektur
- Fachperson Ökologie/Biodiversität
- Kommunale Fachstelle Naturschutz
- Fachperson Mitwirkungsverfahren
Phase 3: Projektierung
-
Erhalt und Förderung zusammenhängender naturnaher Lebensräume
-
Tier- und menschenfreundliche Beleuchtung
-
Minimierung von versiegelten Oberflächen und Schutz von gewachsenem Boden
-
Ausschöpfung der Synergien hinslichtlich Biodiversität, Siedlungsklima, Regenwassermanagement sowie gestalterischer und Nutzungsqualität
-
Standortgerechtete Pflanzenverwendung unter Berücksichtigung von klimatischen Veränderungen
-
Ressourcenschonende Materialisierung, Nutzung von lokalen und nachhaltigen Materialien, Schliessung von lokalen Stoff- und Energiekreisläufen
-
Nutzung von Potenzialen von Gebäuden für Biodiversitätsförderung
-
Erstellung detailierter Umgebungsplan
Phasenbeschrieb
Inhalte gemäss SIA 112:
- Vorprojekt: Optimierung der Konzeption und Wirtschaftlichkeit
- Bauprojekt: Optimierung des Projekts und Kosten, Termindefinition
- Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt: Projektbewilligung, Verifizierung von Kosten und Terminen, Genehmigung Baukredit
Nachdem die Bedürfnisse der Auftraggebenden geklärt sind und die Machbarkeit untersucht worden ist, folgt die Projektierung des Bauvorhabens.
Die Projektierungsphase dient der Vertiefung des Vorprojekts und der Entwicklung des Entwurfs zu einem technisch und gestalterisch ausgereiften, realisierbaren und bewilligungsfähigen Projekt [3]. Die Ziele der Projektierung sind ein bewilligtes Bauprojekt und eine hohe Genauigkeit der Baukosten [7].
Aus Sicht der Biodiversitätsförderung gilt es, die erfassten Naturwerte zu erhalten und die Umsetzung der gesetzten Ziele zur Schaffung naturnaher Grünräume zu konkretisieren. Mithilfe eines Umgebungsplans (oder einer ähnlichen, geeigneten Darstellung) der Aussenräume werden die wesentlichen Gestaltungselemente dargestellt und ökologische Ausgleichsmassnahmen nachgewiesen.
Massnahmen im Detail
Vernetzung und Strukturen fördern
Der Arten- und Lebensraumreichtum wird durch die Anlage neuer Lebensräume gefördert. Die ökologische Vernetzung innerhalb des Projektperimeters und mit bestehenden und neuen Lebensräumen in der Umgebung wird verbessert. Die geltenden Anforderungen (Grund- und erhöhte Anforderungen) und Vorgaben werden erfüllt oder idealerweise übertroffen.
Durch eingeplante Kleinstrukturen (z. B. Wurzelstöcke, Steinhaufen) wird das Lebensraumangebot für Tier- und Pflanzenarten gezielt verbessert.
Pflanzung planen
Die Pflanzengesellschaften werden hinsichtlich ihres Beitrags zur Biodiversitätsförderung, ihren klimatischen Anforderungen, Versorgungsbedingungen und Wachstumseigenschaften gewählt und optimiert.
Es werden bevorzugt standortgerechte und einheimische, möglichst regionaltypische Arten ausgewählt und eingeplant.
Beleuchtung planen
Eine künstliche Beleuchtung wird in Bezug auf Zeit und Ort zielgerichtet und sparsam eingeplant (funktionales Minimum). Übermässige Lichtemissionen werden vermieden.
Materialisierung wählen
Materialisierungskonzepte berücksichtigen die Nachhaltigkeit, ökologische Verträglichkeit und den Rückbau der gewählten Baustoffe.
Regenwassermanagement konzipieren und Versiegelung reduzieren
Der Anteil versiegelter Flächen ist auf das Minimum beschränkt. Im Entwässerungskonzept sind Massnahmen definiert, damit das Regenwasser vor Ort zurückgehalten wird und versickert.
Wo immer möglich, werden wasserdurchlässige Beläge gewählt.
Gebäudebegrünung planen
Bauwerksbegrünungen (Vertikalbegrünung, Dachbegrünung) werden ab Beginn der Projektierung in Überlegungen zur Statik und Gebäudehülle berücksichtigt.
Umgebungsplan erstellen
Der Umgebungsplan stellt ein wesentliches Element dar, mit welchem die Baubewilligungsbehörde die Einhaltung der Gestaltungsgrundsätze prüfen kann. Er wird in vielen Gemeinden als Teil der Baueingabe verlangt. Mit dem Umgebungsplan muss nachgewiesen werden, wie die gute Einordnung in den Aussenraum, die hohe Wohn- und Aufenthaltsqualität sowie der ökologische Ausgleich bewerkstelligt werden. [11]
Unterhaltsplanung
Der Gebäudeunterhalt und entsprechende Zugänge werden bei der Planung der Freiräume mitberücksichtigt, um langfristig naturnahe Lebensräume und Strukturen zu fördern und zu erhalten.
Kosten planen
Die Kosten für die Planung, Ausführung und den fachkundigen Unterhalt einer naturnahen Umgebungsgestaltung sind bekannt und konsequent für alle Phasen budgetiert (Lebenszykluskosten).
Die Finanzierung des Unterhalts der Grünräume wird in der Betriebskostenplanung so berücksichtigt, dass die Qualität der Flächen langfristig gesichert ist.
Weitere Informationen unter Kosten und Nutzen und Naturnahe Pflege.
Akteur:innen
- Bauherr:in
- Bauherrenvertreter:in
- Planungsteam
- Immobilienunternehmen
- Projektleitung
- Fachperson Landschaftsarchitektur
- Fachperson Ökologie/Biodiversität
- Fachperson Grünraumpflege
- Fachperson Kommunikation
- Fachperson Mitwirkungsverfahren
- Kommunale Behörden (Baubewilligung)
- Kommunale Fachstelle Naturschutz
Phase 4: Ausschreibung
-
Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Landschftsachitektur, Gartenbau, Grünraumpflege, Natur-, Ingenieur- und Sozialwissenschaften) fördern
-
Verbindliche Definition der Biodiversitätsziele in den Pflichtenheften für und Werkverträgen mit allen Auftragnehmer:innen
-
Offerten nach Kriterien zur Biodiversitätsförderung beurteilen
Phasenbeschrieb
Inhalte gemäss SIA 112:
- Ausschreibung, Offertenvergleich, Vergabe
- Abschluss von Kauf- und Werkverträgen
Ziel dieser Phase ist es, geeignete Unternehmen und die besten Angebote für eine Bauleistung zu finden. Dabei wird die Planung systematisch in einen Beschrieb überführt, auf dessen Grundlage die Unternehmen Angebote einreichen.
Ein klarer, unmissverständlicher und vollständiger Beschrieb dient der Qualitätssicherung des Projekts und einem möglichst transparenten Angebot seitens der Unternehmen [2][3].
Es ist dafür zu sorgen, dass Anforderungen an die Biodiversitätsförderung – konkretisiert in Bezug auf Qualität und Quantität – in der Ausschreibung hoch gewichtet werden und die gesetzten Ziele auch für die Auftragnehmer:innen verbindlich definiert werden. Dabei ist zu gewährleisten, dass Biodiversitätsfachleute beigezogen werden.
Massnahmen im Detail
Offerten beurteilen
Die Beurteilungskriterien für eingeholte Offerten stützen sich in Bezug auf die Biodiversität auf die definierten qualitativen und quantitativen Anforderungen und Vorgaben. Die Einhaltung der Kriterien wird durch eine qualifizierte Fachperson geprüft.
Pflichtenhefte definieren
Die Pflichtenhefte und Leistungsverzeichnisse für die Erstellung sowie die Pflege der Grünräume definieren die im Gesamtprojekt gesetzten Ziele in Bezug auf die Biodiversität unmissverständlich und vollständig.
Die Verbindlichkeit der Pflichtenhefte sowie deren Durchsetzung und die Erfolgskontrolle werden in den Werkverträgen mit den involvierten Unternehmen festgehalten.
Akteur:innen
- Bauherr:in
- Bauherrenvertreter:in
- Projektleitung
- Fachperson Landschaftsarchitektur
- Fachperson Ökologie/Biodiversität
- Fachperson Grünraumpflege
- Lieferanten
- Unternehmen
Phase 5: Realisierung
-
Schonung von ökologisch wertvollen Lebensräumen, Strukturen und Pflanzen
-
Einhaltung von Richtlinen zum Bodenschutz
-
Beschaffung von Saat- und Pflanzgut bei lokalen Produzenten, fachgereche Kontrolle und Zwischenlagerung von Pflanz- und Saatgut
-
Bewässerung nur dort, wo nötig: bedarfsgerecht und wassersparend
-
Umweltbaubegleitung des Bauvorhabens
-
Umweltschonender und energieeffizienter Transport und Maschineneinsatz
-
Fachgerechte Pflanzung und Aussaat
-
Fachgerechte naturnahe Fertigstellungs- und Entwicklungspflege
Phasenbeschrieb
Inhalte gemäss SIA 112:
- Ausführungsprojekt: Erreichen der Ausführungsreife
- Ausführung: Erstellung des Bauwerks gemäss Pflichtenheft und Vertrag
- Inbetriebnahme, Abschluss: Übernahme und Inbetriebnahme des Bauwerks, Abnahme der Schlussrechnung, Beheben von Mängeln
Das geplante Projekt wird in der Realisierungsphase erstellt. Diese Phase befasst sich mit den Beteiligten, die zur Realisierung des Freiraums beitragen, und deren Tätigkeiten, die mit den Materialflüssen koordiniert werden müssen [2].
Aus Sicht der Biodiversitätsförderung ist zentral, dass die definierten Ziele für eine naturnahe Erstellung und eine naturnahe Pflege von allen Beteiligten eingehalten und dass Schutzbestimmungen für bestehende Lebensräume und Strukturen umgesetzt werden. Nebst dem klassischen Baumanagement und der Bauleitung ist daher die Umweltbaubegleitung durch qualifizierte Fachpersonen in dieser Phase von hoher Bedeutung.
Massnahmen im Detail
Lebensräume und Boden schützen
Als erhaltenswert definierte Lebensräume, Strukturen und Pflanzen (insbesondere Bäume) werden während der gesamten Bautätigkeit geschont. Ein entsprechender Schutzplan ist erstellt und dessen Einhaltung wird regelmässig kontrolliert.
Richtlinien zum Bodenschutz sind definiert und werden eingehalten. Baupisten und Depots für Aushubmaterial werden fachgerecht angelegt und regelmässig kontrolliert.
Freiräume fachgerecht erstellen
Die Erstellung der Freiräume erfolgt fachgerecht anhand detaillierter Ausführungspläne, welche die Besonderheiten von naturnahen Profilen berücksichtigen.
Die Beschaffung und Zwischenlagerung von Saat- und Pflanzgut entspricht den übergeordnet definierten Qualitätskriterien (z.B. Herkunft, Grösse) und wird entsprechend kontrolliert.
Die Bewässerung wird, sofern notwendig, bedarfsgerecht und wassersparend durchgeführt.
Baubegleitung und Erfolgskontrolle
Das Bauvorhaben wird durch Fachpersonen (Naturgartenbau, Landschaftsarchitektur, Umweltbaubegleitung) begleitet und kontrolliert. Das definierte Konzept zur Erfolgskontrolle wird umgesetzt.
Die definierten Kriterien der Erfolgskontrolle werden im Rahmen von Zwischen- und Endabnahmen der erstellten Flächen überprüft. Mängel werden dokumentiert und fachgerecht behoben.
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege
Die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege erfolgt gemäss den definierten Pflichtenheften und den Anforderungen an einen naturnahen Unterhalt.
Zertifizierung abschliessen
Der Zertifizierungsprozess für ein nachhaltiges Label wird abgeschlossen.
Akteur:innen
- Bauherr:in
- Bauherrenvertreter:in
- Projektleitung
- Bauleitung
- Fachperson Landschaftsarchitektur
- Fachperson Ökologie/Biodiversität
- Fachperson Umweltbaubegleitung
- Lieferanten
- Unternehmen
- Behörden
- Zertifizierungsstellen
Phase 6: Bewirtschaftung
-
Erhalt bestehender ökologisch wertvoller Lebensräume und Schaffung neuer Strukturen
-
Abstimmungen der Pflege auf die Standortbedingungen
-
Frühzeitige Anlage von Ersatzstrukturen
-
Fachgerechte Bekämpfung invasiver gebietsfremder Pflanzen
-
Verzicht auf Pestizideinsatz
-
Bodenschonender Unterhalt: Förderung gewachsener Bodenstruktur und -organismen, Vermeidung Bodenverdichtung, kein Bodenauftrag, Verzicht auf Torf
-
Schliessung von lokalen Stoff- und Energiekreisläufen
-
Möglichst geringer Ressourcenverbrauch, Bevorzugung von lokalen und nachhaltigen Materialien
-
Förderung zusammenhängender naturnaher Lebensräume und alter Strukturen
-
Fachgerechte Baumpflege
-
Spontanvegetation zulassen und fördern
-
Bio-konforme Düngung und Pflanzenschutz, aktive Nützlingsförderung
-
Laub nur dort entfernen, wo nötig
-
Bewässerung nur dort, wo nötig: bedarfsgerecht und wassersparend
-
Tier- und ressourcenschonender Maschineneinsatz
-
Langfristige Gewährleistung einer fachgerechten naturnahen Pflege; Sicherung von Kompetenzen und Ressourcen
Phasenbeschrieb
Inhalte gemäss SIA 112:
- Betrieb: Optimierung und Sicherstellung
- Überwachung / Überprüfung / Wartung: Abklärung des Bauwerkzustands, Sicherstellung der Wartung
- Instandhaltung: Aufrechterhaltung der Dauerhaftigkeit und des Werts für die Nutzungsdauer
Im Vergleich zu Gebäuden erfüllen Freiräume ihre volle Funktion erst nach einigen Jahren. Die gewünschte Entwicklung und die Ansprüche an eine naturnahe und biodiversitätsfördernde Pflege der Grünräume müssen vor diesem Hintergrund umsichtig geplant werden.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich naturnahe Lebensräume nicht statisch planen und realisieren lassen. Sie müssen entwickelt werden und sich verändern können und durch entsprechende Fachpersonen mittels gezielter Pflege gelenkt werden.
Die fachkundliche Pflege in den ersten Jahren aber auch langfristig, ist wichtig für die Qualität der Freiräume [1]. Sie bezweckt die Bewahrung und Wiederherstellung der Gebrauchstauglichkeit des Freiraums (Instandhaltung und Instandsetzung). In Bezug auf die Biodiversität optimiert eine naturnahe Pflege das ökologische Potenzial von Teilflächen und des gesamten Freiraums.
Aufgrund von veränderten Anforderungen, zum Beispiel durch Nutzerwechsel oder Bedürfnisveränderungen, kann es notwendig werden, stärker in den Freiräume einzugreifen. Zu solchen Veränderungen zählen die Aufgaben Anpassung, Umbau und Erweiterung , welche ebenfalls Teil der Bewirtschaftung sind. Der Rückbau ist nach SIA 112 nicht explizit Teil dieser Phase, wird hier jedoch ebenfalls berücksichtigt.
Massnahmen im Detail
Die Massnahmen im Detail finden sich unter Naturnahe Pflege.
Akteur:innen
- Bauherr:in
- Bauherrenvertreter:in
- Projektleitung
- Immobilienunternehmen
- (Natur-) Gärtner:innen
- Facility Management
- Eigentümer:innen und Mieter:innen
- Fachperson Ökologie/Biodiversität
- Fachperson Landschaftsarchitektur
- Fachperson Kommunikation
Quellen
Niesel, A. (2017). Nachhaltigkeitsmanagement im Landschaftsbau. Ulmer. elibrary.utb.de
Ehrenbold, N., Haertsch, C., Heide, I., Menz, S., Özdil, E., Paulus, A., Reichel, H., & Zürcher, M. (2022). MAP – Methodische Anwendung zum Planungs- und Bauprozess [Professur für Architektur und Bauprozess ETH Zürich]. MAP – Methodische Anwendung zum Planungs- und Bauprozess. map.arch.ethz.ch
Kommission SIA 112. (2014). SIA 112 Modell Bauplanung—Verständigungsnorm. Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein SIA.
Kommission SIA 105. (2020). SIA 105—Ordnung für Leistungen und Honorare der Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten. Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein SIA.
Küffer, C., Joshi, J., Wartenweiler, M., Schellenberger, S., Schirmer-Abegg, M., & Bichsel, M. (2020). Konzeptstudie—Bausteine für die Integration von Biodiversität in Musterbaureglemente. HSR Hochschule für Technik Rapperswil, ILF Institut für Landschaft und Freiraum.
Kramps, S. (2018). Leitfaden Nachhaltige Freianlagen (S. 165 Seiten) [Leitfaden]. Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL). shop.fll.de
Verein Agglomeration Schaffhausen, quadra gmbh, & Gatti, S. (2017). Arbeitshilfe zur Stärkung der Freiräume in der Planung. Verein Agglomeration Schaffhausen.
Kommission SIA 112/1. (2017). SIA 112/1 Nachhaltiges Bauen—Hochbau—Verständigungsnorm zu SIA 112. Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein SIA.
Kompetenzzentrum Wohnumfeld, & Schöffel, J. (2018). HSR - Wohnumfeld Qualität. wohnumfeld-qualitaet.ch
Steinemann, M., Schwab, S., Stokar, T., & Altermatt, P. (2018). Freiraumentwicklung in Agglomerationen fördern (S. 44 Seiten). Bundesamt für Raumentwicklung, Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Bundesamt für Umwelt BAFU u.a.
Bundesamt für Umwelt BAFU (Hrsg.). (2022). Musterbestimmungen zur Förderung von Biodiversität und Landschaftsqualität im Siedlungsgebiet.
Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein (Hrsg.). (2004). SNARC: Systematik zur Beurteilung der Nachhaltigkeit von Architekturprojekten für den Bereich Umwelt. SIA.
Brunner, W., & Schmidweber, A. (2007). Umweltbaubegleitung mit integrierter Erfolgskontrolle (S. 81). Bundesamt für Umwelt BAFU.
Groupe des Responsables des Etudes d’impact de la Suisse occidentale et du Tessin. (2020). Leitfaden Umweltbaubegleitung (S. 23). Bureau d’etudes SA.
World Health Organisation Regional Office for Europe. (2017). Urban green spaces: A brief for action. Urban Green Spaces: A Brief for Action. euro.who.int
Kommission SIA 112/2. (2016). SIA 112/2 Nachhaltiges Bauen—Tiefbau und Infrastrukturen. Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein SIA.
Kommission SIA 312. (2013). SIA 312:2013—Begrünung von Dächern. Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein SIA.
CRB Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung. (2012). Leitfaden LCC - Planung der Lebenszykluskosten. CRB.
Stadt Bern. (2021). Baumschutz [Inhaltsseite]. Baumschutz Stadt Bern. bern.ch
Umweltbüro Grabher. (2015). Bauvorhaben und Naturschutz. bauaufsicht.net
Bundesamt für Umwelt BAFU. (2001). Bodenschutz beim Bauen (Leitfaden Umwelt LFU, S. 83 Seiten) [Leitfaden]. BAFU. bafu.admin.ch