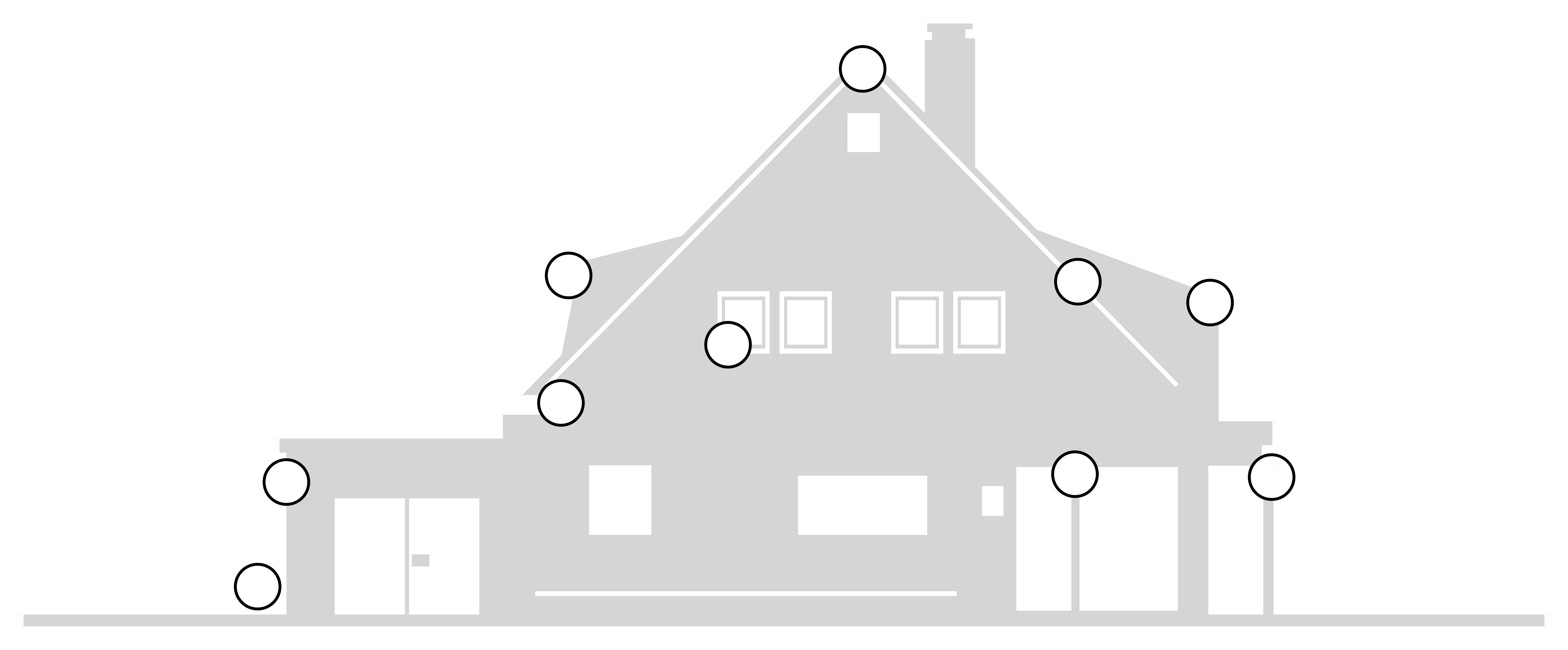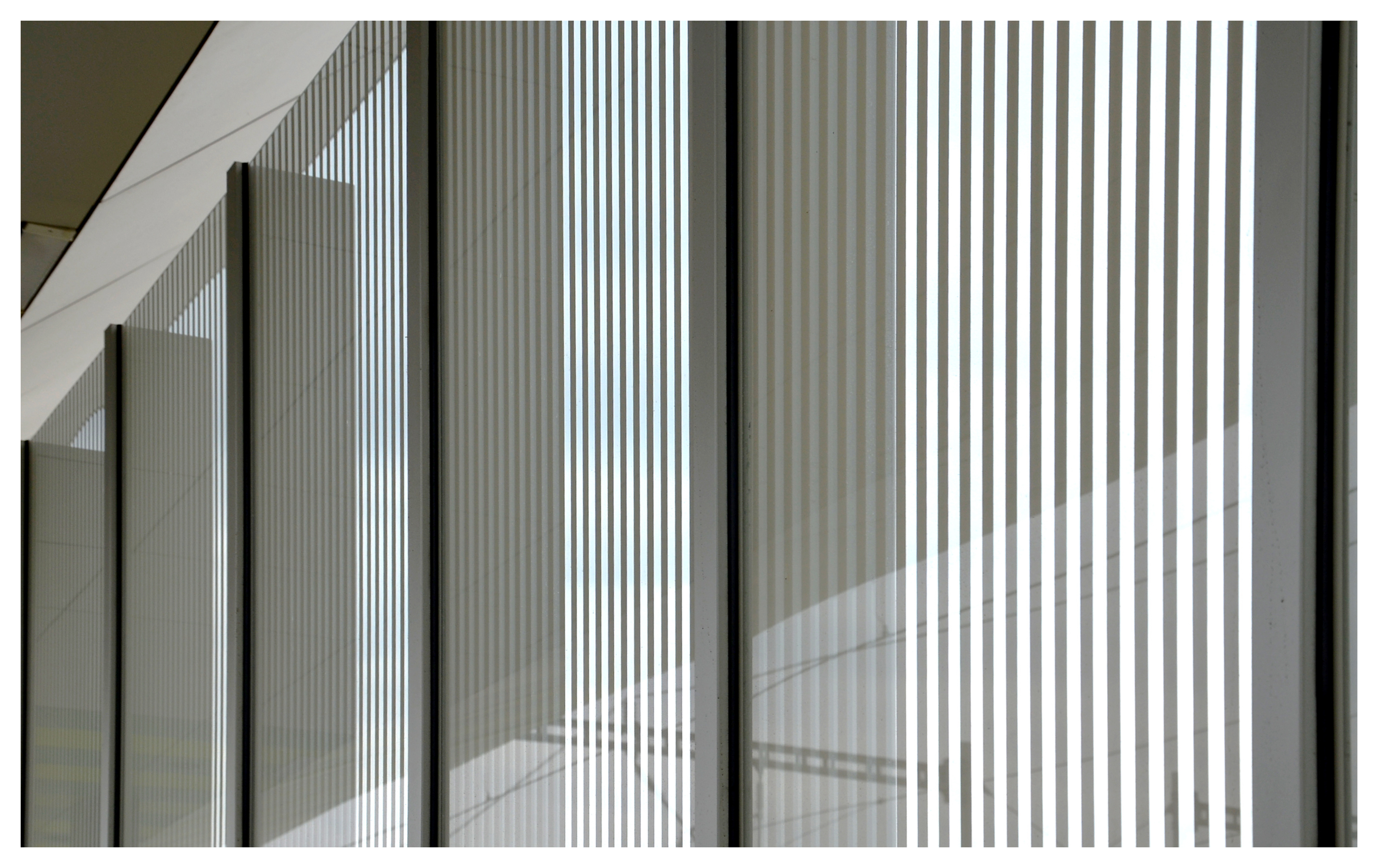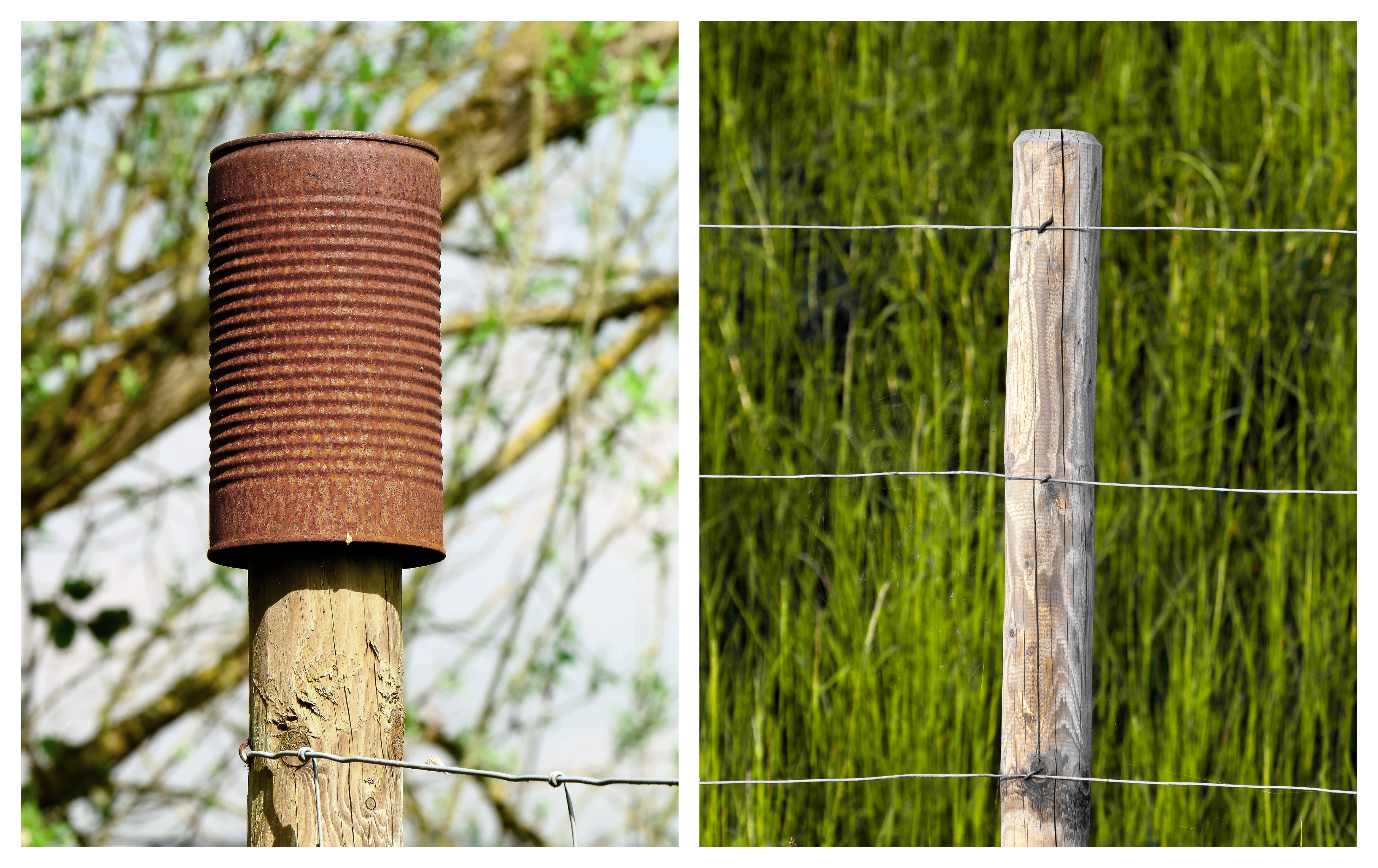In Kürze
Siedlungsgebiete bieten aufgrund ihrer vielfältigen ökologischen Nischen zahlreichen Tieren wertvolle Lebensräume.
Siedlungsgebiete sind Lebensräume mit spezifischen Eigenschaften. Charakteristisch sind die klimatischen Verhältnisse mit Wärme- und Trockeninseln, eine Vielfalt an unterschiedlichen Lebensraumtypen auf kleinem Raum (Habitatmosaik), die Zerschneidung von Lebensräumen aufgrund von Verkehrsachsen und eine räumlich sowie zeitlich variierende Nutzung durch den Menschen. Dadurch bieten Siedlungsgebiete eine Vielzahl an unterschiedlichen ökologischen Nischen, was zu einer hohen Artenvielfalt führt [1].
Eine der grössten Bedrohungen für Wildtiere ist die Zerstörung und der Verlust ihrer Lebensräume. Ausserhalb des Siedlungsgebiets trägt die Intensivierung der Landwirtschaft massgeblich zum Verlust der Biodiversität bei [11]. Entsprechend tragen urbane Räume eine grosse Verantwortung zur Erhaltung der Lebensräume der Wildtiere. Es gilt, bestehende Wildtier-Populationen im Siedlungsgebiet zu erhalten, zu schützen und zu fördern.
Wildtierförderung
Um Wildtiere im Siedlungsgebiet zu fördern, sind diese bereits zu Beginn des Planungsprozesses zu beachten und Fördermassnahmen zu definieren. Dabei gelten folgende Prinzipien:
- Bereits vorkommende Arten, mögliche Barrieren und Vernetzungsmöglichkeiten sowie bestehende Förderkonzepte beachten
- Faunistische Leitarten definieren
- Lebensräume und Strukturen den Bedürfnissen der Leitarten anpassen
- Hindernisse, Fallen und Gefahren minimieren
- Mit Fachpersonen zusammenarbeiten
Tierschonender Unterhalt und Rückbau
Eine tierschonende Pflege von Gebäude und Freiraum kann das Vorkommen und die Förderung von Wildtieren stark beeinflussen. Es gilt tierschonende Maschinen einzusetzen und auf die vorkommenden Tierarten und deren Aktivitätszeiten Rücksicht zu nehmen, um diese möglichst nicht zu stören oder sogar zu verletzen oder zu töten.
Dasselbe gilt auch bei einem Rückbau. Zusätzlich sind viele gebäudebewohnenden Tierarten geschützt, sodass bei einem Rückbau die zuständige Fachstelle Naturschutz kontaktiert werden muss.
Faktenblatt
Das Wichtigste ist in diesem Faktenblatt zusammengestellt.
Potenzial
Vorteile Siedlungsgebiet
Zahlreiche Wildtiere wie Vögel, Fledermäuse oder Insekten nutzen Nischen und Nistgelegenheiten an oder in Gebäuden und profitieren von naturnahen Grünflächen in der unmittelbaren Umgebung. Dabei kann das Siedlungsgebiet als Lebensraum für viele Tierarten Vorteile mit sich bringen [1][2][3][4][5]:
- Hohe strukturelle Diversität auf kleinem Raum
- Geeignete Versteck- und Schlafmöglichkeiten dank eines vielfältigen Angebots verschiedener Lebensräume und Infrastrukturelemente
- Grösseres und konstanteres Nahrungsangebot als im Umland (Abfälle, Haustiernahrung, direkte Fütterung)
- Geringere Sterblichkeit im Winter aufgrund der verbesserten Nahrungsversorgung
- Geringerer Jagddruck durch natürliche Feinde
- Flüsse, Bahndämme und Strassenböschungen als Vernetzungskorridore
Nachteile Siedlungsgebiet
Das Leben im Siedlungsgebiet bringt für Wildtiere aber auch zahlreiche Nachteile mit sich [6][8][9][10]:
- Bejagung durch Hauskatzen (v.a. problematisch für Vögel, Amphibien, Reptilien)
- Fragmentierung der Lebensräume durch Gebäude, Verkehrsachsen und andere versiegelte Flächen
- Erhöhtes Sterberisiko durch Kollisionen mit Fahrzeugen und/oder Gebäuden
- Mehr Lärm und Lichtverschmutzung
- Gefährdung und Verlust der Biodiversität und Lebensraumqualität aufgrund der baulichen Verdichtung und zunehmendem Erholungsdruck auf verbleibenden Grünflächen
- Verlust wertvoller Strukturen an Gebäuden (z.B. Mauernischen, geschützte Winkel) aufgrund moderner Bauweise
- Fallen an Gebäuden, im Garten und in der Landschaft (z.B. grosse Fensterfronten, Schächte)
- Zierpflanzen und Steingärten dienen nur bedingt als Nahrungsquellen resp. Lebensräume
Typische Tierarten
Wildtiere benötigen zum Überleben ausreichende Lebensräume von guter ökologischer Qualität, die möglichst engmaschig miteinander vernetzt sind. Dabei sind sowohl die kleinen als auch die grossen Flächen wichtig, sofern sie eine entsprechende Qualität aufweisen und die Lebensraumansprüche der verschiedenen Tierarten erfüllen [4].
Dazu zählt u.a. ein kontinuierliches, reiches Nahrungsangebot, Fortpflanzungsplätze sowie störungsfreie Überwinterungs- und Rückzugsorte.
Diese finden Wildtiere in naturnahen Freiräumen von Siedlungsgebieten vor. Besonders wertvoll sind Grünräume mit einer hohen Vielfalt an Profilen und Kleinstrukturen. So finden beispielsweise Schmetterlinge auf artenreichen Blumenwiesen Nahrung, Wildhecken oder Parkbäume dienen Amseln oder Distelfinken als Brutplätze und Mauereidechsen nutzen Trockenmauern zum Aufwärmen oder als Rückzugsort.
Wildtiere am Gebäude
Wildtiere nutzen nicht nur Profile und Kleinstrukturen im Siedlungsgebiet, sondern auch Gebäude als Fortpflanzungs-, Rückzugs- oder Überwinterungsort. Dazu zählen beispielsweise Vögel wie Schwalben, Segler oder Dohlen, 18 der 30 einheimischen Fledermausarten sowie viele Insekten wie Wildbienen oder Schmetterlinge.
Besonders wertvoll sind Gebäude aus Stein oder Holz mit zahlreichen Ritzen, Lücken und Vorsprüngen in der Fassade und unter dem Dach. Dies ist insbesondere bei älteren Gebäuden der Fall.
Beispiele für Einschlupfmöglichkeiten am Gebäude für Tiere
Die Unterschlüpfe oder Nistplätze für Tiere befinden sich auf dem Dach und unter Dachvorsprüngen, auf dem Dachboden, an strukturreichen und/oder begrünten Fassaden, an Fenstern und Balkonen, in feuchten Kellern und in anderen wenig genutzten Räumen wie beispielsweise Geräteschuppen.
Für flugfähige Arten bietet das Zwischendach an den Übergängen von Dachrinne, Blechen oder Dachvorsprüngen geeignete Nistplätze oder Rückzugsorte, sofern dort keine Insektengitter angebracht werden.
Das Zwischendach wird beispielsweise von Mauerseglern als Nistplatz und tagsüber von Fledermäusen als Rückzugsort genutzt. Durch Dachvorsprünge entstehen zwischen Dach und Fassade geschützte Winkel, wo beispielsweise Mehlschwalben witterungsgeschützt ihre Nester bauen.
Für Wildtiere gut zugängliche Dachböden bieten im Sommer vorwiegend Dunkelheit und im Winter Schutz vor Wind und Kälte. Aufgrund ihrer Grösse bieten sie oft verschiedene Mikrohabitate, die beispielsweise von Fledermäusen wie der Kleinen Hufeisennase (Rhinolophus hipposideros) oder Schmetterlingen wie dem Tagpfauenauge (Aglais io) genutzt werden.
Selbst Fassaden können Wildtieren Lebensraum bieten, wenn sie ausreichend Nischen aufweisen und nicht aus Glas, sondern Materialien wie Stein, Mörtel oder Holz sind. Wildtiere profitieren insbesondere von begrünten Fassaden, weil sie ihnen Nahrung, Nistplätze und Schutz bieten. Ebenfalls wertvoll sind Naturkeller mit offenen Böden aus Bollen- oder Kieselsteinen, Sandsteinboden oder anderen Naturböden.
Damit Wildtiere am Gebäude geeignete Fortpflanzungs-, Rückzugs- oder Überwinterungsorte vorfinden können, gilt es die artspezifischen Bedürfnisse bereits in der Planungsphase von Neubauten und Sanierungen zu berücksichtigen.
Konkrete technische Lösungen sind beispielsweise der Publikation «Designing for Biodiversity: A technical guide for new and existing buildings» (ISBN 978 1 85946 491 5, kostenpflichtig) zu entnehmen.
Beispiele Tierarten
Typische Tiere, die im Siedlungsgebiet gefördert werden können:
Vögel
Distelfink (Carduelis carduelis), Haussperling (Passer domesticus), Girlitz (Serinus serinus), Amsel (Turdus merula), Kohlmeise (Parus major), Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla), Mauersegler (Apus apus), Alpensegler (Tachymarptis melba), Mehlschwalbe (Delichon urbicum), Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros), Turmfalke (Falco tinnunculus)
Säugetiere
Igel (Erinaceus europaeus), Weissrandfledermaus (Pipistrellus kuhlii), Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii), Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), Siebenschläfer (Glis glis), Eichhörnchen (Sciurus vulgaris)
Reptilien
Blindschleiche (Anguis fragilis), Mauereidechse (Podarcis muralis)
Amphibien
Erdkröte (Bufo bufo), Grasfrosch (Rana temporaria)
Schmetterlinge
Tagpfauenauge (Aglais io), Kleiner Fuchs (Aglais urticae), Taubenschwänzchen (Macroglossum stellatarum), Schwalbenschwanz (Papilio machaon), Admiral (Vanessa atalanta), Distelfalter (Vanessa cardui), Zitronenfalter (Gonepteryx rhamni)
Wildbienen
Gartenhummel (Bombus hortorum), Steinhummel (Bombus lapidarius), Dunkle Erdhummel (Bombus terrestris), Rote Mauerbiene (Osmia bicornis), Grosse Holzbiene (Xylocopa violacea)
Prinzipien
Arten- und Lebensraumförderung findet im Siedlungsgebiet oft auf Flächen statt, die multifunktional genutzt werden (z.B. als Erholungsraum, für Freizeitaktivitäten). Damit ein möglichst konfliktfreies Nebeneinander von Menschen und Wildtieren im Siedlungsgebiet möglich ist, gilt es, auch die Lebensraumansprüche von Wildtieren bereits im Planungs- und Bauprozess einzubeziehen und in der Realisierung und Pflege von Grünräumen zu berücksichtigen [13].
Hierfür kann es hilfreich sein, sogenannte faunistische Leitarten festzulegen. Dabei handelt es sich um Arten, die in bestimmten Lebensraumtypen mit grosser Stetigkeit vorkommen. Es sind standorttypische Arten, deren Vorkommen qualitativ hochwertige und damit artenreiche Lebensräume anzeigen. Leitarten sind attraktiv und leicht erkennbar. Zudem profitieren zahlreiche weitere Arten von den gezielten Fördermassnahmen, die für Leitarten realisiert werden [14]. Ein mögliches Hilfsmittel ist das Auswahlwerkzeug der Vogelwarte.
Anhand der Ansprüche spezifischer Leitarten kann abgeleitet werden, auf welche Profile und Kleinstrukturen sie während ihrem gesamten Lebenszyklus angewiesen sind. Der Lebenszyklus einer Leitart liefert beispielsweise Hinweise darauf, auf welche Nahrungsquellen, Fortpflanzungs- und Rückzugsorte sie innerhalb des Jahres angewiesen ist.
Die Planung mit Hilfe von faunistischen Leitarten ermöglicht es, ein ganzheitliches Konzept mit Massnahmen in den Grünräumen und am Gebäude zu entwickeln.
Für eine wirkungsvolle Umsetzung ist die Zusammenarbeit mit Fachpersonen essenziell [13]. Dies gilt sowohl für Neubauten als auch bei Sanierungen, Umgestaltungen oder beim Rückbau. Drei übergeordnete Erfolgsfaktoren sind entscheidend, damit urbane Räume geschaffen werden können, die für Menschen und Wildtiere gleichermassen lebenswert sind:
- Frühe Einbindung von Artenexpert:innen in der Konzept-/Entwurfsphase des Planungsprozesses, idealerweise in einer kontinuierlichen Zusammenarbeit in interdisziplinären Planungsgruppen
- Partizipative Gestaltung des Planungsprozesses durch die Einbindung von Stakeholdern wie Bauträger:innen, Bewirschaftung/Pflege, Eigentümer/Mieter:innen und Genehmigungsbehörden in den Planungsprozessen
- Aktives Monitoring und eine Auswertung der Ergebnisse nach der Fertigstellung
Vögel
Urbane Räume werden von Vögeln als Sekundärhabitat besiedelt, die sich gut an die vorherrschenden Bedingungen anpassen können. Dazu zählen die drei Gruppen Höhlen- und Felsenbrüter, Waldarten und Nahrungsgeneralisten. Höhlen- und Felsenbrüter nutzen das reiche Angebot an Nischen an Gebäuden als Nistplatz [15]. Beispielsweise schlüpfen Mauersegler (Apus apus) oder Haussperlinge (Passer domesticus) gerne unter den Firstziegel zum Brüten [6]. Waldarten wie die Amsel (Turdus merula) oder das Rotkehlchen (Erithacus rubecula) profitieren von einem vielfältigen Angebot an Bäumen und Wildhecken. Nahrungsgeneralisten wie die Rabenkrähe (Corvus corone corone) oder die Elster (Pica pica) finden im Siedlungsgebiet reichlich Nahrung.
Für die meisten Vögel ist die Anzahl und Grösse der Grünflächen entscheidend: Je mehr verschiedene Lebensräume im Siedlungsgebiet vorkommen, desto höher ist die Artenzahl der Vögel. Im Stadtzentrum ist die Artenvielfalt eher gering und es sind vorwiegend Allerweltsarten anzutreffen (z.B. Strassentaube Columba livia domestica, Haussperling Passer domesticus) oder ehemalige Felsenbrüter wie der Alpensegler (Tachymarptis melba) oder der Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros). Mit zunehmendem Grünanteil kommen vermehrt Waldarten wie die Kohlmeise (Parus major) oder die Mönchsgrasmücke (Tachymarptis melba) vor. Besonders artenreich sind Villenviertel mit grossen Gärten oder Parkanlagen und Friedhöfe mit alten Bäumen [15].
Vögel sind auf ein vielfältiges Nahrungsangebot (z.B. Insekten, Pflanzensamen, Wildbeeren), eine Wasserstelle zum Trinken und Baden, reichlich Verstecke zum Ausruhen und Schlafen sowie geeignete Nistplätze (natürliche wie Baumhöhlen oder künstliche Nisthilfen) angewiesen [16]. Gewisse Arten wie beispielsweise Mauer- und Alpensegler brüten in Kolonien und sind sehr standorttreu. Entsprechend gilt es deren Brutplätze bei Sanierungen oder beim Rückbau zu schützen respektive entsprechende Ersatzmassnahmen zu realisieren.
Optimale Orte zum Ausruhen sind Bäume, Sträucher oder begrünte Fassaden. Sträucher mit Dornen (z.B. Gemeine Berberitze Berberis vulgaris, Schwarzdorn Prunus spinosa) schützen besonders gut vor Feinden wie beispielsweise der Hauskatze [16].
Mit diesen Profilen können Vögel gefördert werden: Blumenrasen, Blumenwiese, Ruderalvegetation, Staudenbepflanzung, Hochstaudenflur, Strauchbepflanzung, Wildhecke, Parkbaum, Vertikalbegrünung, Dachbegrünung, Kleinstrukturen, Trockenmauer, Gewässer ruhend
Säugetiere
Säugetiere kommen in sämtlichen Biotopen vor, beispielsweise an oder in Gewässern, in Wäldern und auf Wiesen ebenso wie in und an Gebäuden. Die Aktivitätsgebiete variieren je nach Art und können wenige Quadratmeter bis zu einigen Hundert Quadratkilometern umfassen. Zu den bekanntesten Vertretern im Siedlungsgebiet zählen Igel, Eichhörnchen und Fledermäuse sowie etwas seltener Haselmaus und Siebenschläfer.
Mit diesen Profilen können Säugetiere gefördert werden: Blumenrasen, Blumenwiese, Ruderalvegetation, Staudenbepflanzung, Hochstaudenflur, Strauchbepflanzung, Wildhecke, Parkbaum, Kleinstrukturen, Trockenmauer, Gewässer ruhend
Reptilien
Reptilien sind im Gegensatz zu Vögeln und Säugetieren wechselwarm. Das heisst, ihre Körpertemperatur hängt von der Umgebungstemperatur ab. Bei zu tiefen Temperaturen drohen ihre Bewegungen so sehr zu verlangsamen, dass sie Feinden nicht mehr entkommen können. Um dies zu verhindern, müssen sich Reptilien an der Sonne aufwärmen oder in ein Versteck zurückziehen können.
Im Gegensatz zu den Amphibien sind Reptilien für die Fortpflanzung nicht auf Wasser angewiesen. Eierlegende Arten (z.B. Ringelnatter (Natrix natrix), Mauereidechse (Podarcis muralis)) vergraben ihre Eier an warmen Stellen wie beispielsweise Komposthaufen oder sandige Mauerspalten.
Alle einheimischen Reptilienarten ziehen sich von etwa Oktober bis März in geeignete Verstecke zurück und fallen in eine Winterstarre. Geeignete Unterschlüpfe sind beispielsweise Baumstrünke, dichte Vegetation, Bodenlöcher, Stein-, Laub- und Komposthaufen.
Reptilien ernähren sich ausschliesslich von anderen Tieren. Echsen fressen Gliederfüsser, Ringelwürmer und Schnecken, Schlangen erbeuten je nach Art Fische, Amphibien, Echsen oder Kleinsäuger [7].
Mit diesen Profilen können Reptilien gefördert werden: Blumenwiese, Ruderalvegetation, Staudenbepflanzung, Hochstaudenflur, Strauchbepflanzung, Wildhecke, Kleinstrukturen, Trockenmauer, Gewässer ruhend
Amphibien
Amphibien sind ans Wasser und an feuchte Lebensräume gebunden. Entsprechend besiedeln sie weniger trockenwarme, urbane Stadtzonen, sondern eher schattigere, naturnahe Lebensräume am Stadtrand.
Mit Ausnahme des lebendgebärenden Alpensalamanders (Salamandra atra) benötigen die heimischen Amphibien Wasser für die Entwicklung ihrer Larven.
Als wechselwarme Tiere suchen Amphibien im Winter einen frost- und störungsfreien Überwinterungsplatz auf, z.B. in einem Erdloch, unter Laub, Moos, Steinen, einem Baumstrunk oder in kleinen Höhlen. Es gibt aber auch Arten, die im Wasser überwintern. Hierfür suchen sie sich eine sauerstoffreiche Stelle im Teich. Während der Winterruhe sind Amphibien inaktiv [7].
Für die Populationsgrösse und Bestandsschwankungen bei Amphibien ist vorwiegend der Fortpflanzungserfolg verantwortlich [17]. Darum sind die Laichgebiete der Amphibien ein Schlüsselhabitat. Dabei ist weniger die Grösse einzelner Flächen, sondern vielmehr die Anzahl der Gewässer sowie das Nebeneinander unterschiedlicher Teilhabitate für die Häufigkeit der Amphibien entscheidend [18].
Für weiherbewohnende Amphibien bräuchte es unterhalb von 1000 m ü.M. schätzungsweise rund 4 Kleingewässer pro km2 (oberhalb von 1000 m ü.M. 1 Gewässer pro km2) inklusive ihrer Landlebensräume [19].
Mit diesen Profilen können Amphibien gefördert werden: Wildhecke, Kleinstrukturen, Trockenmauer, Gewässer ruhend
Insekten
Insekten spielen aufgrund ihrer grossen Vielfalt eine äusserst wichtige Rolle in Ökosystemen und besiedeln alle möglichen Lebensräume im Wasser, zu Land und in der Luft. Zu den wohl bekanntesten Vertretern im Siedlungsgebiet zählen die Wildbienen und Schmetterlinge.
Mit diesen Profilen können Insekten gefördert werden: Blumenrasen, Blumenwiese, Ruderalvegetation, Staudenbepflanzung, Hochstaudenflur, Strauchbepflanzung, Wildhecke, Parkbaum, Vertikalbegrünung, Dachbegrünung, Kleinstrukturen, Trockenmauer, Gewässer ruhend
Bee-Finder unterstützt bei der Feststellung von Wildbienenvorkommen an jedem Standort der Schweiz, priorisiert nach Förderbedarf und berät bei der gezielten Förderung durch Bepflanzung, der Schaffung von Nistplätzen und weiteren Massnahmen.
Verletzte Wildtiere
Verletzte oder kranke Wildtiere gehören in die Obhut von Fachpersonen und sollten daher in eine Pflegestation gebracht werden:
Eichhörnchen
Anweisungen der Eichhörnchenstation Buttwil befolgen
Fledermäuse
Anweisungen der Stiftung Fledermausschutz befolgen
Igel
Anweisungen des Vereins Pro Igel befolgen
Sonstige Säugetierarten (z.B. Fuchs, Dachs, Reh)
Zuständige Wildhüter:in informieren
Vögel
Schweizerische Vogelwarte Sempach kontaktieren
Merkblätter: «Jungvögel - was tun?» oder «Was tun mit Mauersegler?»
Planung
-
Faunistische Leitarten definieren und Fördermassnahmen ableiten
-
Naturnahe Profile und Kleinstrukturen projektieren, langfristiges Bestehen gewährleisten
-
Monitoring sicherstellen
-
Vernetzung und Barrieren berücksichtigen
-
Naturnahe Pflege planen und langfristig gewährleisten
-
Minimierung von Fallen und Hindernissen für Wildtiere
Massnahmen im Detail
Mit gezielten Massnahmen – von ganz einfachen bis aufwendigeren – ist es möglich, Grünräume und Gebäude in wertvolle Lebensräume für Wildtiere zu verwandeln. Dabei geht es um ein ästhetisches und ökologisches Gleichgewicht, damit sich Menschen, Wildtiere und Pflanzen wohlfühlen.
Entscheidend ist, der Natur in einem gewissen Rahmen Entwicklungsraum zu lassen, indem nicht gleich alles weggeräumt und ein gewisses Mass an natürlicher Dynamik zugelassen wird.
Organisches Material beispielsweise dient Kleinstlebewesen als Nahrung und wird auf diesem Weg abgebaut. Werden verblühte Blumen, Laub oder Äste weggeräumt, verschwindet für viele Tierarten ihre Lebensgrundlage.
Grundsätzlich gilt, je mehr verschiedene Profile und Kleinstrukturen auf einem kleinen Raum vorkommen, desto interessanter sind die Grünräume für Wildtiere [12].
Während an einem Ort eine Wildtierart bewusst gefördert und geschätzt wird, wird ihr Vorkommen andernorts nicht toleriert – sie gilt als «unerwünschte Art».
Es gilt möglichst früh im Planungsprozess allfällige Konflikte zu eruieren und mit adäquaten Lösungen vorzubeugen. Partizipative Prozesse und die Sensibilisierung betroffener Akteur:innen können massgeblich zur Akzeptanz von Fördermassnahmen beitragen.
Bestehende Planungsgrundlagen berücksichtigen
Für die Planung von Wildtier-Fördermassnahmen ist es wichtig, in einem ersten Schritt bestehende Planungsgrundlagen zu analysieren, ob es Hinweise auf spezifische Tierarten gibt. Mögliche bestehende Planungsgrundlagen sind:
- Förderkonzepte von Naturschutzfachstellen: Gibt es spezifische Tierarten, die im Gebiet gefördert werden können/sollen?
- Rahmen- und Sondernutzungsplan: Gibt es verbindliche Vorgaben zur Förderung von Gebäudebewohnern und der Entschärfung von Tierfallen?
- Inventare und Schutzverordnungen: Gibt es auf kommunaler Ebene Gebäude mit besonderem Wert für Wildtiere oder Gebäudebrüter? Gibt es auf kantonaler Ebene national oder kantonal prioritäre Gebäudebrüter (z.B. Segler, Schwalben)?
- Leitbilder/Biodiversitätskonzepte (ggfs. im Richtplan): Gibt es auf kommunaler oder kantonaler Ebene Förderkonzepte für Leitarten?
Lebensräume fördern
Bei bestehenden Profilen besteht das Optimierungspotenzial darin, die Pflege zu extensivieren sowie neue Profile und Kleinstrukturen sukzessive zu ergänzen und deren Vernetzung zu optimieren. Dabei ist wichtig, dass die Änderungsschritte sorgfältig und bei Bedarf mit Fachpersonen geplant werden, damit durch die Eingriffe keine bereits existierenden wertvollen Lebensräume zerstört werden. Zudem empfiehlt es sich, grössere Eingriffe etappenweise durchzuführen, damit stets genügend Nahrungsressourcen und Rückzugsmöglichkeiten für Wildtiere bestehen bleiben. Für die Planung von naturnahen Profilen und Kleinstrukturen gilt es die folgenden Prinzipien zu berücksichtigen:
- Eine möglichst hohe Vielfalt an naturnahen Profilen und Kleinstrukturen schaffen, welche auch aus faunistischer Sicht optimal angeordnet sind
- Eine möglichst hohe Vielfalt an einheimischen Pflanzenarten anstreben, die zu verschiedenen Zeitpunkten blühen. Für Insekten ist es wichtig, dass auch Pflanzenarten eingesetzt werden, die ab Juni noch blühen, wenn die meisten Wiesen gemäht und Obstbäume bereits verblüht sind
- Ein hohes Alter von Grünflächen (insb. Bäume) und Kleinstrukturen gewährleisten
- Versiegelte Flächen auf das funktionelle Minimum beschränken, da sie kein Entwicklungspotenzial haben und eine Barriere für viele Tiere bilden können
- Zeitpunkte der Eingriffe beachten: Diese sind ausserhalb sensibler Zeiten (z.B. Brutzeit von Vögeln, Laichzeit von Amphibien) durchzuführen
Zudem sollte eine Vernetzung angestrebt werden:
- Ein dichtes Netz von grossen und kleinen unversiegelten Flächen mit Vegetation sowie lineare Elemente wie Baumreihen oder Wildhecken (Korridore) wirken sich positiv auf die Biodiversität im Siedlungsgebiet aus
- Verkehrsrandflächen bzw. Strassenbegleitgrün können bei geeignetem und naturnahem Unterhalt ein hohes Potenzial für gewisse Lebensräume aufweisen
- Störungen (z.B. Lichtemissionen, Lärm, Nutzungsintensität durch Menschen und Haustiere) reduzieren, da sie die Nutzbarkeit potenzieller Korridore negativ beeinflussen können. Viele Gebiete sind für mobile Tierarten durchgängig, wenn sie zumindest zeitweise (z.B. nachts) störungsfrei oder störungsarm sind [19]
- Für mobile Arten ist grundsätzlich der Anteil und die Anordnung von Grünflächen im Umkreis von ca. 250 bis 1000 m entscheidend. Die Artenzahlen wenig mobiler Arten werden vorwiegend durch Umgebunseinflüsse im Umkreis von bis zu 50 m beeinflusst [21]
Fallen und Hindernisse minimieren
Im Siedlungsgebiet können durch das Anlegen und die Vernetzung von naturnahen Profilen und Kleinstrukturen sowie einer naturnahen Pflege geeignete Lebensräume für Wildtiere geschaffen werden. Dennoch bergen zahlreiche Infrastrukturelemente Gefahren und stellen für Wildtiere Fallen oder unüberwindbare Hindernisse dar. Diese können oft mit einfachen Massnahmen behoben werden. Zu den häufigsten Gefahren im Siedlungsgebiet zählen die folgenden Punkte (siehe auch Übersichtsbroschüre «Tierfallen in Haus, Garten und Landschaft vermeiden» [26].
Glasflächen
Aufgrund der Transparenz oder Spiegelungen von Gläsern erkennen Vögel (z.T auch Federmäuse) Hindernisse in der Landschaft nicht. Folgende Lösungsansätze können übergeordnet zu einer Minimierung des Problems führen:
- Problematik bereits in der Planungsphase miteinbeziehen und bei komplexeren Bauten Fachpersonen beiziehen.
- Idealfall Glastypen einsetzten, die wirksam gegen Vogelschlag sind (z.B. nicht spiegelnde Gläser).
- Ausführliche Lösungsansätze finden sich im Dokument «Vogelfreundlichem Bauen mit Glas und Licht».
Für nachträgliche Lösungen bieten sich folgende Möglichkeiten bei transparenten Scheiben an:
- Durchsichten vermeiden durch: Entsprechende Konstruktion, halbtransparente Materialien oder mithilfe innenarchitektonischer Mittel
- Spiegelungen vermeiden durch: Wahl der Scheiben mit geringem Aussenreflexionsgrad (max. 15%), montieren von Insektenschutzgitter, Verzicht auf Spiegel im Aussenbereich
- Markierung zur Vermeidung von Durchsicht und Spiegelungen sollten flächig sein, aussenseitig angebracht werden, sich vor dem Hintergrund kontrastreich abheben und vorzugsweise mit geprüftem Vogelschutzmuster umgesetzt werden (weiterführende Informationen z.B unter SEEN AG)
- Attraktion vermeiden durch den Verzicht auf Pflanzen hinter Scheiben [22]
Ausführliche Informationen finden sich in «Vogelfreundlichem Bauen mit Glas und Licht», kurzes Merkblatt zu «Vogelfreundlichem Bauen mit Glas» und «Vogelkollisionen an Glas vermeiden».
Bildquelle: Adobe Stock
Schwimmbecken oder Regentonnen
Hineingefallene Wildtiere können an den glatten, Steilen Wänden von Schwimmbecken oder Regentonnen nicht mehr herausklettern. Es bieten sich folgende Lösungen an:
- Schwimmbecken und Regentonnen bedecken
- Ausstiegshilfen anbringen: Ein am Rand befestigtes schräg hineingestelltes Brettchen mit Querleisten installieren
- (Schwimm-)Teiche mit flachen Ufern anlegen
- Schwimmendes rauhes Brett als Ausstiegshilfe für flugfähige Tiere integrieren
Bildquelle: Adobe Stock
Licht- und Lüftungsschächte
Hineingefallene Wildtiere können an den glatten, steilen Wänden nicht mehr hinausklettern oder hohe Stufen überwinden.
- Schacht mit engmaschigem Gitter (Maschenweite max. 3 mm) abdecken
- Schräg hineingestelltes Brett mit Querleisten als Ausstiegshilfe im Schacht anbringen
- Steinpyramische am Rand eines Lichtschachts als Ausstiegshilfe aufschichten
- Treppe mit Zusatztritten versehen, um Tritthöhe zu verringern
- Brett mit Querleisten auf einer Seite der Treppe auslegen
- Schneckenzaun um Schäckte oder Abgänge installieren, da diese meist für Kleintiere unpassierbar sind
Detaillierte Informationen zur Beseitigung von Hindernissen für Igel liefert das Merkblatt «Bahn frei – für die Igel».
Bildquelle: Adobe Stock
Mauern und Zäune
Bis an den Boden gezogene Zäune oder durchgehende Mauern bilden unüberwindbare Barrieren für viele Wildtiere.
- Wildhecken anstatt Zäune und Mauern einsetzen
- Zäune nicht bis an den Boden ziehen (Abstand 15 cm)
- Durchgänge in Zäunen und Mauern mittels Öffnungen am Boden (10 bis 15 cm) gewährleisten
- Versetzte Mauern mit Durchschlupf
Detaillierte Informationen zur Beseitigung von Hindernissen für Igel liefert das Merkblatt «Bahn frei – für die Igel».
Bildquelle: Adobe Stock
Kamine
Offene Kamine können besonders für Vögel oder Fledermäuse zur Falle werden.
- Kaminhüte anbringen
- Fachmännisch angebrachte Gitter
- Detailliertere Informationen dazu liefert das Merkblatt «Vogelfalle Kamine».
Bildquelle: Adobe Stock
Pfosten
Vögel (insb. Jungtiere) können in hohle, oben offene Pfosten hineinrutschen. Schmetterlingsraupen verpuppen beispielsweise in Strassenpfosten, die adulten Falter sind dann aber zu gross, um aus der Öffnung hinauszukommen.
- Pfosten oben abdecken (Platte, Abdecksand)
- Pfosten mit Sand füllen
- Holzpfosten verwenden
Bildquelle: Adobe Stock
Netze
Falsch montierte Abdecknetze (z.B. Nutzgarten, Rebstöcke) stellen für Igel und Vögel eine tödliche Gefahr dar [23]:
- Notwendigkeit der Netze überprüfen.
- Mehr- oder Einwegnetze mit weichen Fäden wählen.
- Netze mit hellen oder auffälligen Farben verwenden.
- Netze gut befestigen und immer spannen.
- Netze über dem Boden spannen und keine losen Netzteile auf dem Boden liegen lassen.
- Netze regelmässig kontrollieren, gefangene Vögel und Igel befreien.
- Nach der Ernte Netze sofort entfernen.
- Detaillierte Informationen dazu liefert das Merkblatt «Alles vernetzt? Anleitung zum korrekten Anbringen von Rebnetzen».
Bildquelle: Adobe Stock
Lichtverschmutzung
Übermässige nächtliche Beleuchtung beeinträchtigt den Lebensraum vieler nachtaktiver Arten, darunter Fledermäuse und Insekten [6]:
- Lichtquellen nur dort anbringen, wo es wirklich nötig ist.
- Bewegungsmelder einsetzen.
- Für Aussenbeleuchtungen UV-arme Leuchtmittel mit einem geringen Anteil an kurzwelligem Licht verwenden, wenn möglich Leuchten mit einer Farbtemperatur von weniger als 2700 K einsetzen.
- Lichtquellen gezielt nach unten richten.
- Geschlossene Gehäuse verwenden, da sich sonst Tiere daran verbrennen können.
- Verzicht auf die Ausleuchtung von Gebäuden oder den Einsatz von Skybeamern. Bei Hochhäusern sollte nach 22 Uhr möglichst kein Licht mehr nach aussen strahlen.
- In der Nähe von Naturräumen nur Natrium-Niederdrucklampen verwenden, sonst nur Natrium-Hochdrucklampen oder warmweisse LED-Lampen verwenden.
- Max. Oberflächentemperatur der Lampen unter 60° C.
Weiterführende Informationen sind der Vollzugshilfe «Empfehlungen zur Vermeidung von Lichtemissionen» des BAFU zu entnehmen.
Bildquelle: Adobe Stock
Gebäudesanierung
- Durch Gebäudesanierungen gehen oft Brutplätze von Vögeln oder Fledermäusen verloren.
- Fachpersonen einbeziehen
- Renovationen ausserhalb der Brutzeit durchführen
- Öffnungen zu den Brutplätzen müssen bestehen bleiben oder geeigneter Ersatz angeboten werden
- Mehr dazu unter Sanierung von Gebäuden
Abfall
- Wildtiere können sich in Abfall verheddern (z.B. Schnüre, Plastikbänder), verletzen (z.B. Glasscherben, Blechdosenränder) oder kleinere Plastikteile über die Nahrung aufnehmen, was zu Komplikationen führen kann.
- Abfälle nie liegen lassen
- Genügend Abfalleimer zur Verfügung stellen
Hauskatzen
Im Schweizer Mittelland sind Hauskatzen die weitaus häufigsten Beutegreifer (Ø 50 bis 60 Katzen pro km2. In Siedlungsgebieten mit besonders hoher Katzendichte und ungenügend Versteckmöglichkeiten für Wildtiere können Katzen zum Verschwinden ganzer Populationen beitragen.
- Nur eine Katze anschaffen, wenn genügend Zeit und Platz vorhanden ist.
- Katze kastrieren lassen, insbesondere Kater streunen dann weniger herum.
- Falls in der Nähe frisch ausgeflogene Jungvögel unterwegs sind, Katze möglichst ein paar Tage nicht aus dem Haus lassen.
- Katzen den Zugang zu Nistplätzen von Vögeln sowie Amphibien- und Reptilienstandorten erschweren (z.B. Manschette aus Blech um Baumstamm anbringen, Steinhaufen oder Trockenmauer mit dornentragenden Sträuchern schützen).
- Nisthilfen an Seitenästen oder an Fassaden in mehr als 1.5 m Höhe aufhängen. Nistkästen mit steilen und glatten Dächern verwenden, damit Katzen keinen Halt darauf finden.
- Vielfalt an Kleinstrukturen und Profilen als Lebensräume für Kleintiere anbieten (z.B. Ast- und Steinhaufen, Trockenmauer, Altgras).
- Vogelbäder und -häuser sowie Nistkästen ausserhalb der Reichweite von Katzen aufhängen [24].
- Erfolgsversprechend (und katzenfreundlich) bei der Reduktion des Jagderfolges der Hauskatzen ist Anlegen von bunten Halskrausen und Katzenglöckchen zur Warnung der möglichen Beutetiere [8] [25].
- Detailliertere Informationen dazu liefert das Merkblatt «Katzen und Vögel».
Realisierung
-
Etablierte Fauna erhalten, schützen und fördern
-
Gestaltung und Anordnung von Lebensräumen und Profilen sind auf die Ansprüche von Wildtieren abgestimmt und untereinander vernetzt
-
Ideale Zeitpunkte für Eingriffe beachten und Übergangslösungen schaffen
-
Konflikte mit «unerwünschten Arten» verhindern
-
Fallen und Hindernisse für Wildtiere entschärfen respektive keine neuen schaffen
-
Naturnahe Erstellungs- und Entwicklungspflege gewährleisten
Massnahmen im Detail
Während der Realisierung soll gewährleistet werden, dass die geplanten Profile und Kleinstrukturen möglichst naturnah umgesetzt werden und zur Vernetzung von Lebensräumen beitragen.
Zudem soll bei bestehenden Anlagen gewährleistet werden, dass grössere Eingriffe etappenweise durchgeführt werden, damit stets genügend Nahrungsressourcen und Rückzugsmöglichkeiten für Wildtiere bestehen bleiben.
Ebenso sollen Fallen und Hindernisse für Wildtiere während der Realisierung entschärft werden bzw. dürfen keine neuen entstehen.
Falls während des Realisierungsprozesses Wildtiere oder ihre Fortpflanzungsstätten und Rückzugsorte entdeckt werden, gilt es primär, sie zu schützen und in jedem Fall Fachexpert:innen beizuziehen. Im Idealfall bleiben die Fortpflanzungsstätten und Rückzugsorte in ihrer Form bestehen.
Falls dies nicht möglich ist, sollten die Arbeiten zumindest bis zum Ausfliegen/Auszug der Jungtiere oder dem Verlassen der Winterquartiere unterbrochen und anschliessend adäquate Ersatzlebensräume zur Verfügung gestellt werden.
Erst als letzte Möglichkeit steht die Umsiedlung der Wildtiere durch Fachexpert:innen an.
«Unerwünschte Arten»
Während an einem Ort eine Wildtierart bewusst gefördert und geschätzt wird, wird ihr Vorkommen andernorts nicht toleriert – sie gilt als «unerwünschte Art».
Das Management dieser «unerwünschten Arten» kann und soll nach möglichst naturnahen und tierfreundlichen Methoden erfolgen.
Ein erster wichtiger Schritt ist, möglichst viele verschiedene Profile und Kleinstrukturen anzubieten. Sie ziehen zahlreiche Nützlinge an, die als natürliche Antagonisten von Schädlingen fungieren können. In Monokulturen können sich Schädlinge viel besser ausbreiten.
Schnecken
Folgende Massnahmen können im Umgang mit Schnecken helfen [27]:
- Nur Nacktschnecken bekämpfen, die meisten Gehäuseschnecken leben von totem Pflanzenmaterial.
- Schneckenfressende Wildtiere im Garten fördern (z.B. Weinbergschnecken, Igel, Blindschleichen).
- Schneckenzäune installieren. Alternativ Zugang zu Pflanzen erschweren: Breite Schicht aus Sägemehl, zerbrochenen Eierschalen oder Kaffeesatz um die Pflanzen streuen.
- Nur am Morgen giessen, weil die nachtaktiven Tiere Feuchtigkeit lieben.
- Pflanzen als Schutz einsetzen, die von Schnecken gemieden werden (z.B. Knoblauch, Zwiebeln, Ringelblumen).
- Schnecken einsammeln, wenn sie aktiv sind (morgens, abends, bei Regen). Alternativ können Holzbretter ausgelegt werden. Darunter bleibt es feucht und die Schnecken können auch tagsüber eingesammelt werden. Beseitigen: Mit kochendem Wasser übergiessen (schneller Tod) oder einfrieren (schmerzloser Tod). Alternative ohne Tötung: Schnecken in einer Entfernung von mind. 200 m freilassen.
- Getötete Schnecken in einiger Entfernung entsorgen, weil sie weitere Schnecken anziehen.
- Sparsamer Einsatz von Dünger und Kompost, weil stark gedüngte Pflanzen Schnecken anziehen.
Blattläuse
Folgende Massnahmen können im Umgang mit Blattläusen helfen [27]:
- Frühzeitig reagieren. Blattläuse absammeln, einzelne stark betroffene Teile abschneiden und robuste Pflanzen mit einem starken Wasserstrahl abspritzen.
- Pflanzenaufgüsse oder -jauchen aus Knoblauch, Brennnessel oder Schachtelhalm einsetzen.
- Natürliche Gegenspieler mit geeigneten Profilen und Kleinstrukturen fördern (z.B. Vögel, Spinnen, Florfliegenlarven, Schlupfwespenlarven, Raubwanzen, Schwebfliegenlarven, Marienkäfer).
- Falls der Befall nicht unter Kontrolle gebracht werden kann, Mittel einsetzen, die ausschliesslich auf Kali-Seife, Rapsöl oder Fettsäuren basieren.
- Natürliche Insektizide wie Pyrethrum oder Azadirachtin wirken nicht spezifisch und töten auch andere Insekten.
Ameisen
Folgende Massnahmen können im Umgang mit Ameisen helfen [27]:
- Ameisen sind wertvolle Schädlingsbekämpfer und „Gesundheitspolizisten“, indem sie totes organisches Material beseitigen, Böden verbessern oder Samen verbreiten. Trotzdem sind sie an gewissen Orten unerwünscht.
- Zugang zu offenen Nahrungsquellen auf Terrassen oder im Haus verhindern.
- Ameisenstrassen mit Klebeband, Kreide oder stark duftenden Stoffen wie Essig, Zitronenschalen oder ätherischen Ölen unterbrechen.
- Ameisen durch wiederholte Störungen vertreiben, z.B. aus Blumentöpfen, indem sie regelmässig stark unter Wasser gesetzt werden.
- Ameisennester umsiedeln. Mögliche Methode: Blumentopf mit Holzwolle füllen, Topf umgekehrt auf das Ameisennest stellen. Sind die Ameisen mitsamt den Puppen eingezogen, kann der Topf an einem geeigneteren Platz positioniert werden (mind. 10 m entfernt).
Wespen
Folgende Massnahmen können im Umgang mit Wespen helfen:
- Wespen sind wertvolle Akteure im natürlichen Gleichgewicht, indem sie grosse Mengen an Mücken, Fliegen und Läusen vertilgen und zugleich Futter für viele Vögel sind. Trotzdem können einige wenige Arten wie die Gemeine Wespe (Vespula vulgaris) oder die Deutsche Wespe (Vespula germanica) durch ihr zudringliches Verhalten in Essensnähe störend sein.
- Keine süssen oder fleischigen Lebensmittel offen liegen lassen, Lebensmittelabfälle und Fallobst schnell wegräumen.
- Mit Wasser anspritzen oder mit Zitronen- und Nelkengeruch (Duftkerze oder halbe aufgeschnittene Zitrone mit Nelken bespickt) vergrämen.
- Wespen nicht wegpusten oder durch fuchteln vertreiben – dadurch werden sie aggressiv.
- Die Gemeine Wespe und die Deutsche Wespe bauen ihre Nester in Hohlräumen. Um Nistplätze an ungünstigen Stellen im Haus zu verhindern, Öffnungen von Beginn weg abdecken.
- Keine Nester zerstören. Falls ein Nest sehr ungünstig liegt, möglichst früh Hilfe von Fachpersonen holen.
- Alte Wespennester: Falls sie an zugänglichen Orten stören, bis März/April entfernen und den Anhaftpunkt mit Seife waschen.
- Verhinderung von Nestgründung im Haus: Im Mai Ausschau halten, ob einzelne Wespen das Haus anfliegen und bestimmte Öffnungen nutzen. Idealerweise mit dem Feldstecher beobachten, um zu identifizieren, ob es sich um harmlose Feldwespen handelt. Handelt es sich um Gemeine Wespen oder Hornissen, kann der Eingang verstopft werden.
Hauskatzen
Folgende Massnahmen können im Umgang mit Hauskatzen helfen [24]:
- Katze kastrieren lassen, insbesondere Kater streunen dann weniger herum
- Falls in der Nähe frisch ausgeflogene Jungvögel unterwegs sind, Katze möglichst ein paar Tage nicht aus dem Haus lassen
- Katzen den Zugang zu Nistplätzen von Vögeln sowie Amphibien- und Reptilienstandorten erschweren (z.B. Manschette aus Blech um Baumstamm anbringen, Steinhaufen oder Trockenmauer mit dornentragenden Sträuchern schützen)
- Nisthilfen an Seitenästen oder an Fassaden in mehr als 1.5 m Höhe aufhängen. Nistkästen mit steilen und glatten Dächern verwenden, damit Katzen keinen Halt darauf finden
- Vielfalt an Kleinstrukturen und Profilen als Lebensräume für Kleintiere anbieten (z.B. Ast- und Steinhaufen, Trockenmauer, Altgras)
- Vogelbäder und -häuser sowie Nistkästen ausserhalb der Reichweite von Katzen aufhängen
Detailliertere Informationen dazu liefert das Merkblatt «Katzen und Vögel».
Strassentauben
Folgende Massnahmen können im Umgang mit Strassentauben helfen [27]:
- Gesimse, die 6 cm oder schmaler sind oder einen Neigungswinkel von mind. 45 ° aufweisen und verblecht sind, können von Tauben nicht genutzt werden.
- Gliederbögen (Schwanenhals) der Regenfallrohre unter dem Vordach stärker abfallend konstruieren. Dadurch finden Tauben keinen Halt mehr und es benötigt keine Anti-Tauben-Dornen (Verletzungsgefahr für Fledermäuse, Kleinvögel).
- Dachöffnungen mit Brettern, Holzlamellen und Guttern auf weniger als 10 cm Höhe/Durchmesser verkleinern.
- Kontaktabwehrsysteme versperren Tauben auf geeigneten Sitzplätzen den Platz. Wichtig: Fachgerechtes Anbringen, regelmässige Kontrolle und Unterhalt. Förderung und Ansiedlung von Wander- und Turmfalken, die sich u.a. von Tauben und ihren Jungvögeln ernähren.
- Verjagen: Wenn sich Tauben auf einem Balkon einrichten, möglichst von Anfang an stören. Besonders wirksam sind Störungen nach Einbruch der Dunkelheit.
- Falls Strassentauben und Fledermäuse den gleichen Dachboden nutzen, Fledermausexpert:innen beziehen.
Fuchs
Füchse, die ihre natürliche Scheu vor Menschen verlieren, können zu Problemen führen. Eine zentrale Rolle spielen dabei Nahrungsquellen [12]:
- Abfallsäcke in Containern entsorgen
- Keine Füchse füttern
- Fleischabfälle nicht auf den Kompost geben
- Fuchskot im Abfall entsorgen und danach gründlich die Hände waschen
- Gemüse aus dem Garten gründlich waschen (Fuchsbandwurm)
- Hunde und Hauskatzen regelmässig entwurmen (Fuchsbandwurm)
Füchse graben gerne Gänge, um Futter zu verstecken. Dies kann teilweise an ungünstigen Orten sein. Oft sind die Gänge weniger als 1 m lang und werden nie benutzt.
- Wichtig ist, die Gänge zuzuschütten, bevor sie zu tief gegraben werden. Damit keine Tiere eingesperrt werden, sollte der Gang in einem ersten Schritt vorsichtshalber nur locker mit Erde zugeschüttet oder mit einem Gegenstand verstopft werden, der sich leicht wegschieben lässt.
- Erneutes Graben erschweren: Gang zuerst mit Geröll, Backsteinen o.ä. füllen, anschliessend mit Erde bedecken. Drahtgeflecht darüber legen.
Dachs
Dachse, die gefüttert werden, verlieren oft ihre Scheu. Sie können aufdringlich und bissig werden und müssen dann erlegt werden [12]:
- Dachse nicht füttern
- Knochen und Abfälle im Abfall und nicht auf dem Kompost entsorgen. Komposte zudecken
- Picknickabfälle entsorgen
- Abfallsäcke in Containern aufbewahren oder erst am Morgen des Abfuhrtags hinausstellen
- Bei Begegnungen dem Dachs stets einen Fluchtweg offen lassen
Wildschwein
Wildschweine, die gefüttert werden, verlieren oft ihre Scheu. Sie können aufdringlich und bissig werden und müssen dann erlegt werden [12]:
- Wildschweine nicht füttern
- Knochen und Abfälle im Abfall und nicht auf dem Kompost entsorgen. Komposte zudecken
- Picknickabfälle entsorgen
- Abfallsäcke in Containern aufbewahren oder erst am Morgen des Abfuhrtags hinausstellen
- Bei Begegnungen dem Wildschwein stets einen Fluchtweg offen lassen
- Ausgrenzung von Wildschweinen: Installation massiver Zäune mit teilweise eingegrabenen Gittern
Mäuse
Bei Problemem mit Mäusen gilt es grundsätzlich, Fachpersonen zu kontaktieren (Biosuisse-zertifizierte Kammerjäger).
Prävention:
- Nahrungsmittel in gesicherten Räumen oder unzugänglichen Gefässen lagern (z.B. Glas anstatt Plastik/Karton)
- Essensreste nicht via Ausguss oder WC entsorgen
- Volle Müllsäcke am Tag der Abfuhr entsorgen und nicht draussen zwischenlagern, Fleischabfälle nicht auf den Kompost geben
Bekämpfung:
- Mäuse können mit verschiedenen Fallen tot oder lebendig gefangen werden
- Als Köder eignet sich eine Mischung aus Nahrungsmitteln und blutgerinnungshemmenden Substanzen
Ratten
Bei Problemen mit Ratten gilt es grundsätzlich, Fachpersonen zu kontaktieren (Biosuisse-zertifizierte Kammerjäger).
- Nahrungsmittel in gesicherten Räumen oder unzugänglichen Gefässen lagern (z.B. Glas anstatt Plastik/Karton)
- Keine Futterstellen für Haustiere im Garten
- Fallobst nicht liegen lassen
- Essensreste nicht via Ausguss oder WC entsorgen
- Volle Müllsäcke am Tag der Abfuhr entsorgen und nicht draussen zwischenlagern, Fleischabfälle nicht auf den Kompost geben
- Eindringen durch bauliche Massnahmen verhindern (z.B. engmaschige Gitter vor Kellerfenstern)
Steinmarder
Steinmarder einzufangen und wegzubringen nützt nichts, weil sie stets dieselben Reviere besetzen.
- Bauliche Abwehrmassnahmen sind wirkungsvoller als akustische oder geruchliche. Im Herbst ausführen, wenn die Jungtiere weg sind
- Einschlupflöcher vergittern oder verschliessen
- Manschetten an Regenfallrohren, Blitzableitern und Pfosten anbringen: 70 bis 100 cm lang, 2 m über dem Boden bzw. über dem Dach eines Anbaues.
- Abhebbare Dachziegel fixieren
- Nahe ans Gebäude ragende Baumäste bis auf mind. 2 m Abstand stutzen
- Attraktivität in der Umgebung verringern durch: Komposthaufen abdecken, keine Speisereste in den Kompost geben
Siebenschläfer
Durch ihren Nagetrieb können Siebenschläfer Materialschäden verursachen und durch ihren Kot/Urin Räume oder Waren verschmutzen. Zudem können sie nachts relativ viel Lärm verursachen.
- Teile des Dachbodens, die absolut frei von Siebenschläfern sein sollen, mit gut schliessenden Türen und Lochblechen über den Mauerkronen abschliessen
- Keine Glaswolle oder Flocken bei der Wärmedämmung verwenden, da dieses lose Material gerne zum Nestbau verwendet wird
- Wegräumen und vertreiben: Falls Siebenschläfer als störend empfunden werden, abklären, ob sie schon Junge haben. Wenn dies nicht der Fall ist, Vertreibung versuchen. Dabei eignen sich starke Gerüche wie Räucherstäbchen, Pfeffer, Essig, Eukalyptus-Öle oder andere ätherische Öle usw. Wirkungslos sind Ultraschallgeräte und laute Musik
- Fangen und aussetzen: Rat und Unterstützung von Wildhütern oder einer professionellen Schädlingsbekämpfungsfirma beanspruchen. Wichtig: In der Schweiz sind Siebenschläfer in mehreren Kantonen geschützt und dürfen nur mit Bewilligung eingefangen werden
Vorbeugen:
- Siebenschläfer hinterlassen Duftmarkierungen auf ihren Pfaden. Um die Besiedlung von Gebäuden zu unterbinden, müssen diese Pfade unterbrochen und Gebäudeteile unzugänglich gemacht werden
- Baumäste, die näher als 1 m an das Haus reichen und Kletterpflanzen ca. 1 m unter dem Dach kappen
- Prüfen, ob Türen dicht schliessen und mögliche Zugänge abdichten
- Aufstiegsrouten mit Manschetten um Rohre und Blitzableiter unterbrechen
- Schornsteinöffnungen engmaschig vergittern (Rücksprache mit Schornsteinfeger!)
- Zurückversetzte Lochbleche einbauen, damit Unterschlupfmöglichkeiten für Fledermäuse und Vögel erhalten bleiben.
- Siebenschläfer-Nistkästen am Waldrand als Ersatz anbieten
Pflege
-
Lebensräume und Kleinstrukturen möglichst naturnah und extensiv pflegen
-
Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und Schneckenkörner
-
Ungestörte Bereiche zulassen
-
Sanierungen tierschonend konzipieren und umsetzen
-
Einsatz von tierschonenden Geräten wie Balkenmäher, Sense, Rechen oder Handarbeit
-
Lebenszyklus von Wildtieren bei Pflegemassnahmen berücksichtigen
-
Tierschonender Gebäudeunterhalt
Massnahmen im Detail
Prinzipien tierschonende Grünraumpflege
Zudem gilt es, die Prinzipien der tierschonenden Pflege von Grünräumen zu beachten. Details sind bei den jeweiligen Profilen beschrieben.
Verzicht auf:
- Mähroboter, Rotationsmäher, Tellersensen, Freischneider, Laubbläser und Laubsauger, weil sie Wildtiere schwer verletzen oder töten können. Alternativen: Balkenmäher, Sense, Rechen, Handarbeit
- Chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel
Alternativen: Biologischer Pflanzenschutz (Prävention, technische Massnahmen, Einsatz von Nützlingen (Fressfeinde oder Parasiten der Schädlinge) und natürliche Pflanzenschutzmittel (z.B. Pflanzenjauche aus Brennnesseln oder Ackerschachtelhalmen)
Wiesen, Rasen und Krautsäume
- Vor Mäharbeiten hohe Vegetation auf die Anwesenheit von Tieren kontrollieren
- Möglichst wenige Schnitte und späte Schnittzeitpunkte im Jahr
- Bei Mäharbeiten Schnitthöhe mind. 15 cm über Boden, damit ohne Schaden über Kleinsäugernester, Junghasen oder Igel hinweggemäht wird
- Grossräumig durchgehende Verbindungslinien von dichter Gras- und Krautvegetation von mind. 30 cm Höhe gewährleisten
- Bereiche von Wiesen, Rasen und Krautsäumen über den Winter stehen lassen, weil sie eine wichtige Deckung sind
- Verfilzte Gras- und Krautschicht dulden, weil sie gute Verstecke bieten
- Nicht unter Gehölzen mähen, damit dort ein dauerhafter Sichtschutz für kleinere Säugetierarten bleibt (z.B. Winternester von Haselmäusen, Tagesverstecke von Igeln)
Hecken
- Form- und Wildhecken ausserhalb der Brutzeit von Vögeln schneiden: Ab Oktober bis Anfang März schneiden
- Bei Dornengehölzen Quirlschnitt fördern, weil sich dadurch für Vögel gute und teilweise katzensichere Nistgelegenheiten ergeben
Park-, Strassen- und Obstbäume
- Schnitt ausserhalb der Brutzeit von Vögeln: Ab Oktober bis Anfang März schneiden
- Bei Höhlenbäumen auf überwinternde Fledermäuse kontrollieren
Nutzgarten
- Verzicht auf Schneckenkörner
- Erst im Frühling und nicht schon im Herbst «aufräumen»
Kleinstrukturen
- Laub liegen lassen oder zu Laubhaufen aufschichten
- Schnittgut von Bäumen und Sträuchern für Asthaufen verwenden
- Ast- und Laubhaufen (falls überhaupt) erst ab April wegräumen, damit Wildtiere während der Winterruhe nicht gestört werden
- Asthaufen nicht verbrennen, weil sonst Wildtiere sterben, die sich darin aufhalten
- Totholz bestehen/liegen lassen, sofern keine Gefahr besteht
Fledermausverträgliche Holzschutzmittel verwenden
- Noch besser: Witterungsbeständige und robuste Holzarten verwenden, die nicht imprägniert werden müssen
- Unbedenkliche Holzschutzmittel immer nur bei Abwesenheit der Fledermäuse einsetzen
Prinzipien tierschonender Gebäudeunterhalt
Zeitpunkt
- Eingriffe möglichst bei Abwesenheit der Wildtiere durchführen
- Lebenszyklen von Wildtieren bei Pflegemassnahmen berücksichtigen (z.B. nicht während Brutzeit von Vögeln, Winterschlaf von Fledermäusen)
Fledermausverträgliche Holzschutzmittel verwenden
- Noch besser: Witterungsbeständige und robuste Holzarten verwenden, die nicht imprägniert werden müssen
- Unbedenkliche Holzschutzmittel immer nur bei Abwesenheit der Fledermäuse einsetzen
Präventive Massnahmen
- Falls «unerwünschte Arten» zu Konflikten führen, können im Rahmen des Gebäudeunterhalts präventive Massnahmen getroffen werden (z.B. Verschliessung von Öffnungen innerhalb von Rollladenkästen, die von Haussperlingen als Nistplätze genutzt werden. Dies muss allerdings ausserhalb der artspezifischen Brutzeit stattfinden, da die Nester nicht zerstört werden dürfen).
Sanierungen
Bei Sanierungen von Gebäuden besteht die Gefahr, dass gebäudebewohnende Wildtiere gestört, verletzt oder schlimmstenfalls getötet sowie ihre Lebensräume dauerhaft zerstört werden.
Viele dieser Gebäudebewohner sind geschützte Arten (z.B. Fledermäuse, Schwalben, Segler). Dazu zählen beispielsweise die Nistplätze von Vögeln wie Mauerseglern oder Mehlschwalben sowie die Quartiere von Fledermäusen.
Häufig finden die Wildtiere nach der Sanierung in energetisch optimierten Gebäuden keine geeigneten Nischen mehr vor [28]. Dabei würden sich Sanierungen anbieten, um neue Lebensräume für gebäudebewohnende Wildtiere zu schaffen.
Durch eine entsprechende Bauherrenberatung, wie dies beispielsweise die Einwohnergemeinde Cham anbietet, können gebäudespezifische Lösungen für Nistplätze entwickelt werden.
Um Konflikte zu vermeiden, gilt es, bereits in der Planungsphase Fachexpert:innen einzubeziehen – je früher, desto besser. Dabei sollen insbesondere die folgenden Punkte zur Erhaltung von Quartieren berücksichtigt werden:
- Zeitpunkt: Sanierungen bei Abwesenheit der Wildtiere durchführen. Bei den meisten Arten ist dies ab September bis März möglich.
- Einflug- und Niststellen erhalten: Öffnungen und Nischen möglichst nicht verändern. Wildtiere bleiben eher an einem Gebäude, wenn nicht alle Bereiche gleichzeitig saniert oder umgebaut werden. Wenn der Umbau gestaffelt erfolgt, sind gleichzeitig alte und neue Nist- oder Quartierbereiche vorhanden. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass das Gebäude von den Wildtieren nicht aufgegeben wird. Falls nicht anders möglich, anschliessend wieder instand stellen. Dies ist insbesondere bei Fledermäusen heikel, daher muss mit einer Fachperson zusammengearbeitet werden [12].
- Wiederherstellen/Ersatz bieten: Die ursprünglich vorhandenen Einschlupföffnungen oder Nist- und Quartiermöglichkeiten sollten unbedingt wieder an der gleichen Stelle angeboten werden [12].
- Übergangslösungen planen: Wenn bei einer Sanierung ein Lebensraum vollständig betroffen ist, sollte in unmittelbarer Umgebung ein adäquater Ersatzlebensraum geschaffen und die Tiere dahin umgesiedelt werden. Nach der Wiederherstellung des ursprünglichen Lebensraums werden sie wieder zurückgeholt, dies funktioniert allerdings nicht immer. Eine Begleitung durch Fachpersonen ist vorausgesetzt [12].
- Beteiligte informieren: Alle am Bau beteiligten Personen über die Wildtiere und ihren Schutz informieren (Architektur- und Baubüros, Handwerksbetriebe).
- Massnahmenkontrolle: Richtige Umsetzung der Baumassnahmen überprüfen [29].
Vögel
Alle nicht jagdbaren Vogelarten sind gesetzlich geschützt (Eier, Jungvögel und Adultvögel) Das Brutgeschäft darf nicht gestört und ihre Lebensräume nicht zerstört werden.
Zudem ist gesetzlich festgelegt, dass bei Beeinträchtigungen der Verursacher entweder für die Wiederherstellung oder einen angemessenen Ersatz zu sorgen hat.
In gewissen Fällen wie beim Abriss einer Liegenschaft ist eine Zerstörung nicht vermeidbar. Unter diesen Umständen ist das Bauvorhaben auf die Brutzeit der Vögel abzustimmen: Sanierungen sollen ausserhalb der Brutzeit stattfinden [30].
Bereits in der Planungsphase von Sanierungen sollten die Lebensraumansprüche und Brutperioden gebäudebrütender Vögel berücksichtigt und Fachpersonen beigezogen werden.
Mauer- und Alpensegler
Die Nistplätze befinden sich fast ausschliesslich in Hohlräumen an mehrstöckigen Gebäuden. Jedes Jahr werden dieselben Nistplätze aufgesucht, das Finden neuer Brutnischen fällt den Seglern schwer.
Bauliche Veränderungen können Nistplätze für Segler leicht wertlos machen. Besonders einschneidend sind Baugerüste und Bauarbeiten während der Brutperiode Zwischen April und August, da sie zur Aufgabe des Standorts, zum Brutverlust oder sogar zum Tod von Alttieren führen können.
Bei Sanierungen während der Brutzeit können Massnahmen wie eine zeitliche Staffelung der Arbeiten, Lücken im Baugerüst oder Ersatzangebote am Gerüst ein Weiterarbeiten erlauben.
Im Idealfall werden die Sanierungen aber ausserhalb der Brutzeit durchgeführt. Dann müssen keine zusätzlichen Schutzmassnahmen getroffen werden. Die Stellen, an denen sich Nistplätze befinden, sollten vor Beginn der Bauarbeiten gekennzeichnet werden.
Falls eine Zerstörung sich nicht vermeiden lässt, müssen in der nächsten Brutperiode an den gleichen Stellen wieder Nistplätze vorhanden sein. Alternativ muss möglichst nahe an den ursprünglichen Nistplätzen Ersatz bereitgestellt werden. Alte Nester sollten aufbewahrt und in den neuen Nisthöhlen wieder angeklebt werden.
Die Nistplätze müssen in der darauf folgenden Brutzeit ungehindert zugänglich sein und es darf für die Segler keine Brutsaison ausfallen, sonst kehren sie nicht mehr an die Brutplätze zurück [30].
Detailliertere Informationen zu Baufragen rund um Nistplätze von Mauer- und Alpenseglern sind in der Broschüre «Nistplätze für Mauer- und Alpensegler» zu finden.
Mehlschwalbe
Die Nistplätze von Mehlschwalben befinden sich aussen an Gebäuden, wo die Nester unter Vordächern aus ton- oder kalkhaltigem Erdmaterial gebaut werden.
Alternativ nehmen Mehlschwalben auch Kunstnester an (Bestellmöglichkeit Kunstnest). Sie brüten bevorzugt in Gruppen und benutzen die Nester über mehrere Jahre. Detaillierte Informationen, was bei Arbeiten an Gebäuden mit Mehlschwalben zu beachten ist, sind im Faktenblatt «Unter einem Dach mit der Mehlschwalbe»
Hausrotschwanz
Bevorzugt werden Nistplätze an halboffenen, meist schwer zugänglichen Stellen wie Giebelbalken oder Mauervorsprüngen. Alternativ werden auch Nistkästen für Halbhöhlenbrüter angenommen (weitere Informationen und Bestellmöglichkeit).
Fledermäuse
Fledermäuse sind bedroht und bundesrechtlich geschützt. Damit ihre Quartiere durch Sanierungen nicht beeinträchtigt oder zerstört werden, gilt es, bereits in der Planungsphase die Stiftung Fledermausschutz oder die Kantonalen Fledermausschutz-Beauftragten zu verständigen (kostenlose Beratung).
Die Erhaltung der Quartiere ist meist mit einfachen Massnahmen möglich, sofern die Ansprüche der Wildtiere bereits in der Planung eines Bauvorhabens berücksichtigt werden.
Die wichtigsten Punkte für den Erhalt von Fledermausquartieren bei Sanierungen sind:
- Durchführung der Arbeiten bei Abwesenheit der Fledermäuse
- Keine Veränderung an den Hangplätzen und den Ein- und Ausflugöffnungen
- Keine Veränderung des Mikroklimas im Quartier
- Verzicht auf giftige Holzschutzmittel
- Keine oder eine angepasste Aussenbeleuchtung [28]; Direktes Licht bei der Öffnung oder beim Ausflugweg von Fledermausquartieren vermeiden [29]
Weiterführende Informationen:
- Merkblatt «Fledermäuse und Bauarbeiten»
- Merkblatt «Fledermausfreundliche Sanierungen»
- Merkblatt «Konfliktlösungen bei Fledermäusen am Haus»
Monitoring
Ein Erfolgsmonitoring ist das zentrale Instrument zur Qualitätssicherung.
Ideal ist ein jährliches kurzes Reporting zu den umgesetzten Massnahmen und den dabei gemachten Erfahrungen. Damit lässt sich der Umsetzungsprozess beurteilen und bei Bedarf anpassen. Dies setzt allerdings den Einbezug von Fachpersonen voraus. Rahmenbedingungen [13]:
Formulierung von überprüfbaren Zielen
- Definition von Indikatoren, die eine Messung der Zielerreichung/Wirkung ermöglichen
- Parallele Planung und Durchführung von Erfolgskontrollen und Umsetzung einer Massnahme
Das Projekt «Siedlungsnatur gemeinsam gestalten» beschreibt ausführlich das Vorgehen und die Indikatoren für eine langfristige Qualitätssicherung. Mögliche Indikatoren für Wirkungsziele können beispielsweise sein [31]:
- Das Verhältnis der biodiversitätsfördernden Flächen zur Grundstücksfläche bleibt mindestens erhalten oder wird vergrössert.
- Das Pflegekonzept ist erstellt und wird fachgerecht umgesetzt.
- Die Aufenthaltsqualität bleibt mindestens erhalten oder wird verbessert.
Für das Monitoring von Wildtieren können Fachpersonen beauftragt werden. Falls aufgrund eingeschränkter finanzieller Ressourcen der Einbezug von Fachpersonen nicht möglich ist, können lokale Natur- oder Vogelschutzvereine beigezogen oder mit Hilfe der nachfolgenden Punkte ein vereinfachtes Monitoring durchgeführt werden:
- Können die festgelegten Leitarten auf dem Areal nachgewiesen werden (z.B. durch Beobachtung, Nage- oder Kotspuren, Nester, Jungtiere)?
- Zeiträume (Tages- und Jahreszeit) beachten, in denen die Antreffwahrscheinlichkeit der verschiedenen Arten am höchsten ist.
- Werden die angelegten Profile und Kleinstrukturen wildtiergerecht gepflegt (z.B. Heckenschnitt zw. Oktober und März, Verzicht auf Rasenroboter)?
- Wurden Gefahren und Hindernisse für Wildtiere entschärft?
- Müssen zusätzliche Massnahmen ergriffen werden, um die Profile/Kleinstrukturen vor Störungen (z.B. Lärm, Lichtverschmutzung) zu schützen?
- Falls Profile und Kleinstrukturen von Wildtieren nicht genutzt werden: Woran könnte es liegen? Gibt es allenfalls unüberwindbare Hindernisse und Barrieren? Könnte die Vernetzung des Areals optimiert werden? Benötigen gewisse Profile mehr Zeit, damit sich die Vegetation etablieren kann und sie von den Wildtieren angenommen werden? Ist das Potenzial des Areals vollständig ausgeschöpft? Gibt es Bereiche, wo die Eingriffe durch die Pflege weiter reduziert werden könnten? Wie ist die Akzeptanz der Profile und Kleinstrukturen durch die Anwohner:innen/Nutzer:innen? Sind Sensibilisierungsmassnahmen notwendig?
Basierend auf dem Monitoring sind Optimierungsmassnahmen zu planen und umzusetzen.
Rückbau
-
Fachpersonen beiziehen
-
Übergangslösungen prüfen
-
Wenn möglich wertvolle Bereiche erhalten
-
Umsiedelung von Wildtieren prüfen
Massnahmen im Detail
Beim Rückbau von Profilen, Kleinstrukturen oder Gebäuden besteht die Gefahr, dass Wildtiere gestört, verletzt oder schlimmstenfalls getötet sowie ihre Lebensräume dauerhaft zerstört werden.
Um Konflikte zu vermeiden, gilt es, bereits in der Planungsphase Fachexpert:innen einzubeziehen – je früher, desto besser. Dabei sollen insbesondere die folgenden Fragen zum Schutz der Wildtiere geklärt werden:
- Müssen alle Bereiche des Aussenraums/Gebäudes, die von Wildtieren genutzt werden, zurück gebaut werden? Gibt es Bereiche, die aus faunistischer Sicht besonders wertvoll sind und bestehen bleiben können?
- Kann der Rückbau in einem Zeitraum stattfinden, in dem die tierischen Bewohner die Lebensräume nicht nutzen oder zumindest die Fortpflanzungszeit abgeschlossen ist?
- Können während des Rückbaus Übergangslösungen (z.B. externe Nisthilfen als Ersatz für Gebäudenischen) angeboten werden?
- Können gewisse Wildtiere vor dem Rückbau umgesiedelt werden?
Bestimmungen
Gesetzliche und planerische Grundlagen für die Planung, Realisierung, Pflege und Rückbau (kein Anspruch auf Vollständigkeit):
Ebene Bund
Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) und -verordnung (NHV)
- Die einheimische Tierwelt ist zu schützen
- Es ist untersagt die Eier, Nester, Brutstätten von geschützten Tieren zu beschädigen oder wegzunehmen
- Alle Gebäudebewohnenden Arten sind geschützt: Fledermäuse, Amphibien, Reptilien, Haselmaus, Baumschläfer, Spitzmäuse, Igel, Vögel, Raubtiere, Eichhörnen
- Zusätzlich geschützte Arten: Bspw. Spitzmäuse, Fledermäuse, Baumschläfer
Jagd- (JSG) und Tierschutzgesetz (TSchG)
- Alle Tiere, die nicht zu einer jagdbaren Art (bspw. Fuchs, Dachs, Marder, Tauben) gehören, sind geschützt
- Keinem Tier darf ungerechtfertigt Schmerzen, Leiden, Schäden oder Angst zugefügt werden
Berner Konvention
- Verbot von Beschädigen und Zerstören von Brut- und Raststätten
- Verbot von mutwilliger Beunruhigen wildlebender Tiere, besonders während des Brütens, Jungenaufzucht oder des Überwintern
- Verbot von Zerstören oder Entfernen von Eiern
Ebene Kantone und Gemeinden
- Kantonale Naturschutzgesetzgebung und kantonale Planungs- und Baugesetze
- Rahmen- und Sondernutzungsplanung
- Inventare und Schutzverordnungen
- Kommunale und kantonale Leitbilder und Biodiversitätskonzepte
Normen und Labels
- Label Grünstadt Schweiz
- Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz
- Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung (CRB)
- ECO-BKP 421
Weitere
- Grün- und Freiraumkonzepte
- Landarchitektonische, planerische und städtebauliche Wettbewerbe
- Landschaftsentwicklungskonzepte
Graf, R. F., & Fischer, C. (Hrsg. ). (2021). Atlas der Säugetiere—Schweiz und Liechtenstein. Schweizerische Gesellschaft für Wildtierbiologie SGW, Haupt Verlag, Bern.
Bateman, P. W., & Fleming, P. A. (2012). Big city life: Carnivores in urban environments. Journal of Zoology, 287(1), 1–23. doi.org
Breuste, J., Pauleit, S., Haase, D., & Sauerwein, M. (2016). Stadtökosysteme. Springer Berlin Heidelberg. doi.org
Di Giulio, M. (2016). Förderung der Biodiversität im Siedlungsgebiet: Gute Beispiele und Erfolgsfaktoren. Haupt Verlag.
Suter, W. (2017). Ökologie der Wirbeltiere: Vögel und Säugetiere (1. Auflage 2017). Haupt Verlag.
BirdLife Schweiz. (2019). Tierfallen in Haus, Garten und Landschaft vermeiden (S. 31). birdlife.ch
Ineichen, S., Klausnitzer, B., & Ruckstuhl, M. (Hrsg.). (2012). Stadtfauna: 600 Tierarten unserer Städte (1. Aufl). Haupt.
Kistler, C., Gloor, S., & Tschanz, B. (2013). Hauskatzen und Wildtiere im städtischen Umfeld—Übersicht über die aktuelle wissenschaftliche Literatur (S. 41 Seiten). SWILD Zürich.
Obrist, M., Sattler, T., Home, R., Gloor, S., Bontadina, F., Nobis, M., Braaker, S., Duelli, P., Bauer, N., Della Bruna, P., Hunziker, M., & Moretti, M. (2012). Biodiversität in der Stadt – für Mensch und Natur (Praxismerkblatt Nr. 48; S. 12 Seiten). Eidg. Forschungsanstalt WSL. dora.lib4ri.ch
Schweizerische Vogelwarte. (2020). Nisthilfen für einheimische Vögel.
BirdLife Schweiz. (2020). Biodiversität: Wo steht die Schweiz? (S. 24).
Stocker, M., & Meyer, S. (2012). Wildtiere: Hausfreunde und Störenfriede (1. Auflage). Haupt Verlag.
Tschander, B. (2014). Konzept Arten- und Lebensraumförderung. stadt-zuerich.ch
Pfiffner, L., & Graf, R. (2010). Mit Leitarten die Vielfalt fördern. Ökologie & Landbau, 155(3), 46–48.
Gerber, M. (2016). BirdLife-Lehrgang Feldornithologie. BirdLife Schweiz, Zürich.
Horch, P., & Burkhardt, M. (2007). Vögel rund ums Haus. Schweizerische Vogelwarte, Sempach.
Ryser, J., Borgula, A., Fallot, P., Kohli, E., & Zumbach. (2002). Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung: Vollzugshilfe. (Nr. 8810; Vollzug Umwelt, S. 77). Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL).
Oertli, B., Joye, D., Castella, E., & Juge, R. (2002). Does size matter? The relationship between pond area and biodiversity. Biological Conservation, 104(1), 59–70. doi.org
Guntern, J., Lachat, T., Pauli, D., & Fischer, M. (2013). Flächenbedarf für die Erhaltung der Biodiversität und der Ökosystemleistungen in der Schweiz. Forum Biodiversität Schweiz der Akademie der Naturwissenschaften SCNAT, Bern. scnat.ch
Küffer, C., Joshi, J., Wartenweiler, M., Schellenberger, S., Schirmer-Abegg, M., & Bichsel, M. (2020). Konzeptstudie—Bausteine für die Integration von Biodiversität in Musterbaureglemente. HSR Hochschule für Technik Rapperswil, ILF Institut für Landschaft und Freiraum.
Gloor, S., Bontadina, F., Moretti, M., Sattler, T., & Home, R. (2010). BiodiverCity: Biodiversität im Siedlungsraum. (S. 40 Seiten) [Ergebnisse eines Projekts]. Bundesamt für Umwelt BAFU. biodivercity.ch
Schmid, H., Doppler, W., Heynen, D., & Rössler, M. (2012). Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht [Broschüre]. Schweizerische Vogelwarte. vogelwarte.ch
Siegfried, W., Linder, C., & Perrottet, M. (2010). Alles vernetzt? Anleitung zum korrekten Anbrignen von Rebnetzen (Merkblatt 404, S. 4). Forschungsanstalt Agroscope Changings-Wädenswil ACW.
Rudin, M., & von Hirschheydt, J. (2014). Katzen und Vögel – Merkblatt (S. 2 Seiten) [Merkblatt]. Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz. birdlife.ch
Geiger, M., Kistler, C., Mattmann, P., Jenni, L., Hegglin, D., & Bontadina, F. (2022). Colorful Collar-Covers and Bells Reduce Wildlife Predation by Domestic Cats in a Continental European Setting. Frontiers in Ecology and the Environment, Volume 10.
BirdLife Schweiz. (2021). Fallen und Hindernisse für Tiere. birdlife.ch
Tschäppeler, S., & Haslinger, A. (2021). Natur braucht Stadt—Berner Praxishandbuch Biodiversität. Haupt Verlag.
Stiftung Fledermausschutz. (2021). Renovationen. Fledermausschutz. fledermausschutz.ch
Bundesamt für Umwelt BAFU. (2011). Gebäudesanierungen: Vogel- und fledermausfreundlich. bafu.admin.ch
Scholl, I. (2016). Nistplätze für Mauer- und Alpensegler—Praktische Informationen rund um Baufragen. birdlife-zuerich.ch
Di Giulio, M., Hauser, K., Martinoli, D., Mathey, B. (2022). Modul 8 - Wirkungsorientierung & Qualitätssicherung. Siedlungsnatur gemeinsam gestalten.