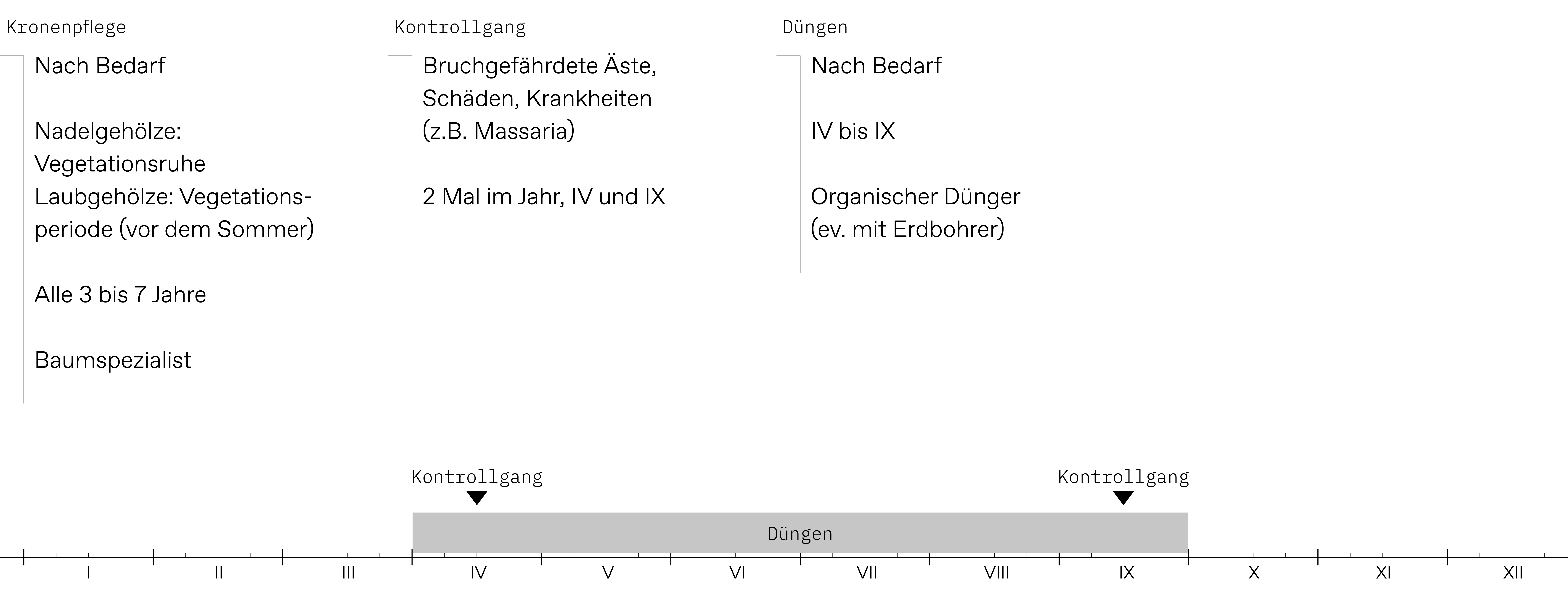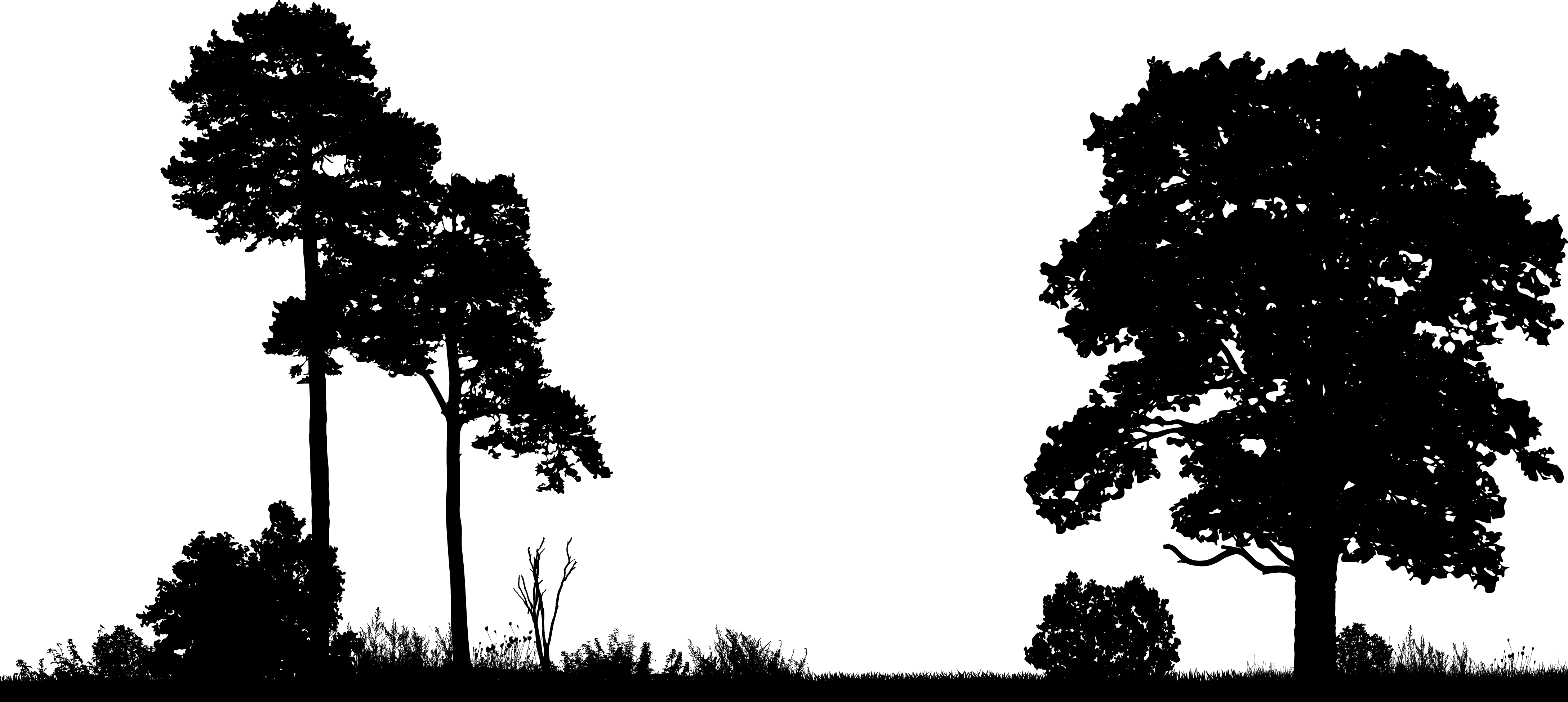
In Kürze
Parkbäume haben einen grossen Einfluss auf die urbane Biodiversität und das Siedlungsklima.
Kurzdefinition
Unter Parkbäumen werden alle Bäume zusammengefasst, welche in Parkanlagen, Wohnumfeldern, Firmenarealen, Haus- und Villengärten verwendet werden. Bei Parkbäumen wird die natürliche Wuchsform möglichst belassen, sowie nach Möglichkeit Wildformen verwendet.
Biodiversitätsförderung
Wird das Profil wie auf dieser Seite beschrieben geplant, realisiert und gepflegt, weist es folgende Potenziale auf:
hoch = • • • • • tief = • negativ = (•)
Ökologische Vernetzung
• • • •
Lebensraum für Wildtiere
• • • •
Lebensraum für Wildpflanzen
• •
Ökologischer Ausgleich
• • • •
Anforderungen
Grundsätze
Mit der Erfüllung dieser Grundsätze wird die Biodiversität gefördert.
Saat- und Pflanzgut
> Stufe 2 Biodiversitätsindex
> 80% einheimische und standortgerechte Unterpflanzung
Hohe Artenvielfalt
0% invasive gebietsfremde Gehölze
Aufbau
Unterpflanzung
Pflege
Möglichst gesamte Fläche gemäss Prinzipien naturnahe Pflege
Artgerechter, schonender, der natürlichen Wuchsform entsprechender Rückschnitt
Baumpflege durch zertifizierte Baumpfleger:innen
Nutzung
Keine aktive Nutzung
Standort
Schattig bis sonnig
Trocken bis feucht
Erhöhte Anforderungen
Mit der Erfüllung dieser erhöhten Anforderungen wird die Biodiversität noch stärker gefördert.
Saat- und Pflanzgut
> Stufe 3 Biodiversitätsindex
100% einheimische und standortgerechte Unterpflanzung
Mindestgrösse
> 0.75 m3 Wurzelraum pro 1 m3 Kronenvolumen
> 36 m3 Wurzelraum pro Baum
Pflege
100% der Fläche gemäss Prinzipien naturnahe Pflege
Faktenblatt
Das Wichtigste ist in diesem Faktenblatt zusammengesellt.
Definition
Unter Parkbäumen werden Laub- und Nadelbäume, sowohl Pionier-, Übergangs- und Klimaxarten, von Klein- bis Grossbaum zusammengefasst, die in Parkanlagen, Wohnumfeldern, Firmenarealen, Haus- und Villengärten verwendet werden.
Bäume, welche im Strassenraum verwendet werden, werden im Profil Strassenbaum (in Bearbeitung) behandelt.
Laubbäume bilden in der Regel Kronen aus und haben einen weniger aufrechten Wuchs als Nadelbäume. Bei Parkbäumen werden die natürliche Wuchsform möglichst belassen respektive gefördert, sowie Wildformen statt Sorten verwendet.
Potenzial
Wird das Profil wie auf dieser Seite beschrieben geplant, realisiert und gepflegt, weist es folgende Potenziale auf:
hoch = • • • • • tief = • negativ = (•)
Ökologische Vernetzung
• • • •
Lebensraum für Wildtiere
• • • •
Lebensraum für Wildpflanzen
• •
Ökologischer Ausgleich
• • • •
Hitzeminderung
• • • • •
Verbesserung Luftqualität
• • • • •
Versickerung und Wasserretention
• • • •
Bodenschutz und Versiegelung
• • •
aktive Nutzung
• • •
passive Nutzung und Aufenthaltsqualität
• • • • •
Nutzung, Gestaltung und ökologisches Potenzial
Bäume bieten ein breites Spektrum an Leistungen, die durch Menschen direkt und indirekt genutzt werden (Ökosystemleistungen).
Bäume werden als schattenspendender Ort genutzt, ermöglichen Naturerlebnis, fungieren als Treffpunkt und wirken als Elemente der Raumgliederung.
Der Nutzen, der indirekt aus der Anwesenheit von Parkbäumen entspringt, umfasst Luftkühlung, Lärmminderung, Luftreinigung und damit Minderung von Gesundheitsrisiken. Weitere Leistungen umfassen die Minderung der Windgeschwindigkeit, Sauerstoffproduktion, CO2-Bindung, Erhöhung der Luftfeuchtigkeit, und Erhöhung der Biodiversität durch Schaffung von Lebensraum für diverse Organismen [1][2][3][4][5][6]. Das Ausmass der Ökosystemleitungen unterscheidet sich nach Grösse, Vitalität und Baumart [2].
Ab einer Grösse von einem Hektar bildet sich in Grünräumen ein eigenes Mikroklima aus, das sich auch in die Umgebung überträgt [7]. So kann die städtische Oberflächentemperatur tagsüber um bis zu 1°C je 10% kronenbedeckter Fläche gesenkt werden [5]. Die Kühlwirkung erreicht das Quartier nur optimal bei offen gestalteten Rändern, wobei der Wirkungsradius 200 bis 300 m beträgt [7].
Als gestalterisches Element von Parkanlagen sind Bäume dominant, indem sie das Gesamtbild der Anlage prägen. Beispiele für die vielfältigen Möglichkeiten der Gestaltung sind prägnante Einzelbäume, Baumgruppen, Alleen, Ufersäumung, Begrenzung von Flächen oder ganzen Parks, Prägung von Sichtachsen, oder Baumsammlungen (Arboreten). Dabei können unterschiedlichste Wuchsformen zum Einsatz kommen.
Bäume sind ökologisch wertvoll, da sie die vertikale Dimension erschliessen und eine Vielfalt unterschiedlicher Lebensräume beherbergen. Ihre Bedeutung für die Biodiversität steigt mit zunehmendem Alter und Kronenvolumen [8].
Durch intensive Forstwirtschaft sind sehr alte Bäume weitgehend aus den Wäldern verschwunden, im Siedlungsgebiet konnten sie in alten Parks, Gärten und Alleen jedoch erhalten werden und nehmen so die Funktion eines Ersatzhabitates ein [9,10].
Die Anzahl baumbewohnender Arten unterscheidet sich von Baumart zu Baumart. Einen guten Überblick bietet beispielsweise der Biodiversitätsindex 2021 für Stadtbäume im Klimawandel.
Die Anzahl an Arten kann durch naturnahes Laubmanagement erhöht werden, da auch dies ein Habitat darstellt. Bäume mit mindestens einem Mikrohabitat – also kleinräumigen oder speziell abgegrenzten Lebensräumen, wie etwa Höhlungen, Rissen, Spalten – werden als Habitatbäume bezeichnet und können diverse Organismen beherbergen, die auf diese Lebensräume angewiesen sind. Habitatbäume sollten in ein behördenverbindliches Inventar aufgenommen und gesondert geschützt werden [12].
Typische Pflanzen
Im Folgenden werden unter den Laubbäumen nur solche aufgeführt, die nach dem Biodiversitätsindex 2021 für Stadtbäume im Klimawandel in der Kategorie Parkbäume einen Wert >4 aufweisen.
Bei den Nadelbäumen ist dies nicht möglich, da keine Art mit >4 bewertet wurde. Unter dem Wildobst sind Arten mit besonders hohem Biodiversitätsindex gekennzeichnet.
Es ist zu beachten, dass eine gemischte Pflanzung verschiedener Baumarten zu einer höheren Biodiversität führt als einzelne Baumarten mit hohem Biodiversitätsindex [11][14][15]. Wo es die Standorteigenschaften zulassen, sollten möglichst einheimische Baumarten als Parkbaumarten verwendet werden.
Beispiele Pflanzenarten
Mit diesem Profil können zum Beispiel folgende Pflanzenarten gefördert werden:
Laubbäume
Feldahorn (Acer campestre), Spitzahorn (Acer platanoides), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Buche (Fagus sylvatica), Esche (Fraxinus excelsior), Apfel (Malus sp.), Schwarzpappel (Populus nigra), Stieleiche (Quercus robur), Traubeneiche (Quercus petraea), Silber-Weide (Salix alba), Sal-Weide (Salix caprea), Winterlinde (Tilia cordata), Sommerlinde (Tilia platyphyllos)
Nadelbäume
Weisstanne (Abies alba), Fichte (Picea abies), Wald-Föhre (Pinus sylvestris), Eibe (Taxus baccata), Lärche (Larix decidua)
Wildobst
**=Biodiversitätsindex > 4
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Süsskirsche (Prunus avium**), Traubenkirsche (Prunus padus), Roter Holunder (Sambucus racemosa), Echter Wacholder (Juniperus communis), Elsbeerbaum (Sorbus torminalis), Pflaume (Prunus domestica**), Speierling (Sorbus domestica), Vogelbeere (Sorbus aucuparia)
Unter infoflora.ch sind sämtliche Arten dieses Profils bzw. Lebensraumes zu finden.
Problempflanzen
Folgende Arten dürfen nicht als Parkbäume verwendet werden, da sie invasives Potenzial besitzen.
Invasive und gebietsfremde Arten unter Beobachtung
Chinesische Samtpappel (Abutilon theophrasti), Götterbaum (Ailanthus altissima), Blauglockenbaum (Paulownia tomentosa), Herbst-Kirsche (Prunus serotina), Essigbaum (Rhus typhina), Robinie (Robinia pseudoacacia), Fortunes Hanfpalme (Trachycarpus fortunei)
Typische Tiere
Viele Arten sind spezialisiert auf bestimmte Baumarten, so finden sich beispielsweise bis zu 500 Arten, die auf Eichen spezialisiert, also zumindest sehr stark von Eichen abhängig sind [16]. Die Eiche ist die einheimische Baumart, die von der grössten Anzahl an Arten besiedelt wird. Allein 179 Grossschmetterlingsarten und 900 bis 1000 Käferarten wurden an Eichen nachgewiesen [9][17]. Linden, im Vergleich dazu, beherbergen etwa 300 Käferarten [9].
Da sehr viele Arten auf Totholz als Lebensraum angewiesen sind, ist das Belassen von stehendem und liegendem Totholz – sofern es die Verkehrssicherheit nicht einschränkt – ein wichtiges Element der strukturellen Artenförderung [18]. Auch das Belassen von Baumstubben ist beispielsweise für Hirschkäferarten wichtig [9].
Die Anzahl an Tierarten an Gehölzen steigt bei Durchmischung der Baumarten und guter Vernetzung durch Grünkorridore innerhalb grosser Parkanlagen und mit dem Umland [6]. Strukturreichtum, geeignete Unterpflanzungen (z.B. Blumenwiesen, Strauchbepflanzungen), Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse, sowie die Schaffung von diversen Kleinstrukturen, fördern die faunistische Vielfalt weiter.
Beispiele Tierarten
Typische Tiere, die mit diesem Profil gefördert werden können [6][9][15][19]:
Vögel
Buntspecht (Dendrocopos major), Grünspecht (Picus viridis), Kleiber (Sitta europaea), Girlitz (Serinus serinus), Kohlmeise (Parus major), Feldsperling (Passer monta-
nus), Tannenmeise (Periparus ater), Zilpzalp (Phylloscopus collybita), Sommergoldhähnchen (Regulus ignicapilla)
Säugetiere
Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii), Eichhörnchen (Sciurus vulgaris), Siebenschläfer (Glis glis), Gartenschläfer (Eliomys quercinus)
Schmetterlinge
Tagpfauenauge (Aglais io), Grosser Schillerfalter (Apatura iris), C-Falter (Polygonia c-album), Ulmen-Zipfelfalter (Satyrium w-album), Nierenfleck (Thecla betulae), Admiral (Vanessa atalanta)
Wildbienen
Blaue Holzbiene (Xylocopa violacea), Hahnenfuss-Scherenbiene (Chelostoma florisomne), Holzameise (Lasius sp.), Gartenhummel (Bombus hortorum), Steinhummel (Bombus lapida-
rius), Wiesenhummel (Bombus pratorum), Baumhummel (Bombus hypnorum), Rote Mauerbiene (Osmia bicornis)
Problemtiere
Da alte Parkbäume eine besonders hohe Bedeutung für die Biodiversität haben, sind mögliche Schäden durch Problemtiere frühzeitig zu erkennen und Massnahmen gegen diese durchzuführen. Mögliche Massnahmen umfassen das Entfernen von befallenen Ästen, das Absammeln der Tiere oder die Förderung der Vitalität der Bäume und der natürlichen Feinde. Die folgenden aufgeführten Tierarten können Schäden an Parkbäumen anrichten:
Asiatischer Laubholzbockkäfer (Anoplophora glabripennis)
Absterben von Laubhölzern
Blausieb (Zeuzera pyrina)
Ausbohrlöcher, kann in extremen Fällen zum Absterben des Baums führen
Eichen-Prozessionsspiner (Thaumetopoea processionea)
Starke allergische Reaktionen bei Menschen
Eichensplintkäfer (Scolytus intricatus)
Absterben von jungen Eichen
Kiefern-Prozessionsspinner (Thaumetopoea pinivora)
Starke allergische Reaktionen bei Menschen
Standort
Böden alter Parkanlagen und Villengärten unterscheiden sich stark von den sonst oft stark gestörten Böden des Siedlungsgebietes durch ihre Tiefgründigkeit und humose Schichtung [20].
In entwickelten Parkanlagen, Villengärten und Friedhöfen handelt es sich um ein relativ naturnahes Umfeld, in dem die Lebenserwartung der Bäume entsprechend hoch ist. Bei sorgfältiger Auswahl und Pflege, können diese sehr gross und alt werden. Neuanlagen von Freiräumen auf gestörtem Untergrund, oder aber kleinräumigen Parks (Pocket Parks) unterscheiden sich stark von diesem Bild.
Aus den vielfältigen einheimischen Baumarten konnte bisher für alle Standorte die passende Art gefunden werden. Um die Resilienz der Bepflanzung gegenüber Schädlingen oder veränderten Klimabedingungen zu erhöhen, sollten gemischte Pflanzungen ausgeführt werden.
Zielbild
Bäume können in Parks und Gartenanlagen sehr gross werden, je nach Art bis zu 40 m. Sie können solitär, in Gruppen, als Wälder, Alleen, zur Flächenbegrenzung oder anderer Art von Raumgliederung (Sichtachsen) eingesetzt werden. Sie sollten so lange als möglich gehalten werden.
Um einen klimatisch und ökologisch optimalen Effekt zu erzielen, besteht ein geplanter Freiraum aus einer Kombination von Wiese mit Krautsäumen, Sträuchern und einem lockeren Baumbestand, sowie einem durchlässigen Rand zu angrenzenden Gebieten. Durch Höhenstaffelung werden die unterschiedlichen Kühleffekte der horizontalen Schichtungen erzielt und gleichzeitig für eine faunistische Vielfalt erschlossen. Auch wird so ein Dacheffekt des oberen Stockwerkes verhindert, wodurch Durchlüftung und Lichteinfall erhalten bleiben. Eine extensive Pflege sollte vorgesehen werden [7][23].
Da der Kühleffekt in 200 bis 300 m Entfernung verbraucht ist, wäre ein Netz von Freiräumen in Abständen von 400 bis 600 m aus siedlungsklimatischer Sicht optimal [7]. Eine solche Verteilung in Verbindung mit Bäumen fördert gleichzeitig die Biodiversität effektiv.
Bäume in Verbindung mit Unterpflanzung und verschiedenen Strukturen in der Umgebung, wie Gehölzsäume, Blumenwiesen, Teichen, oder Bächen, machen den Park nicht nur zu einem vielseitigen und artenreichen Lebensraum, sondern auch attraktiv für Menschen, die nachgewiesenermassen eher strukturreiche Grünflächen bevorzugen [24].
Eine Laubschicht, Strukturelemente wie Nisthilfen, sowie Stein- oder Asthaufen erschliessen weitere ökologische Nischen.
Beispiele
Sammlung von Beispielen, die im Siedlungsgebiet von Schweizer Gemeinden und Städten angelegt wurden.
Planung
-
Boden- und Standortanalyse für Bepflanzungskonzept vornehmen
-
Potenzial von standortgerechten und einheimischen Baumarten ausschöpfen und hohe Pflanzenvielfalt anstreben
-
Kleine Pflanzgrössen einplanen
-
Krautsaum vorsehen und fördern
-
Bestehende Pflanzen nach Möglichkeit erhalten
-
Wurzelechte Baumarten (keine Veredelung, keine Sorgen), Ökotypen und Naturverjüngung beachten
-
Unterpflanzung vorsehen und fördern
-
Pflege von Beginn an mitberücksichtigen
Massnahmen im Detail
Vorhandenen Baumbestand erhalten
Ein wichtiges Ziel einer nachhaltigen Grünraumentwicklung ist es, Bäume als zentrale Grünstruktur im Siedlungsgebiet möglichst lange zu erhalten. Mit zunehmendem Alter steigt ihre Bedeutung als Lebensraum [9], ihre allgemeinen Ökosystemleistungen, sowie ihr emotionaler Wert für Menschen.
Innerhalb des Planungsprozesses muss der Baumbestand frühzeitig durch eine Fachperson (Baumspezialist:in) erfasst und dessen Erhaltungswürdigkeit individuell beurteilt werden. Zu betrachten sind Alter, Baumart, Gesundheitszustand (Vitalität), ökologisches und Entwicklungspotential.
Die notwendigen Massnahmen zum Erhalt der Bäume, sowie der erforderlichen Verkehrssicherheit sollen während dieses Vorgangs festgelegt werden.
Ersatzpflanzung im Bestand planen
Fallen Bäume in einem älteren Bestand aus und es soll nachgepflanzt werden, so müssen zuerst die Ursache für den Ausfall und die für eine Nachpflanzung notwendigen Schritte geklärt werden.
Mögliche Ursachen können beispielsweise Alter, Beschädigung durch Baumassnahmen, Gasleckagen, Grundwasserabsenkungen, Krankheiten/Schädlinge, Bodenverdichtung, Vernässung, oder Immissionen sein [25].
Pflanzung planen
In der Studie Biodiversitätsindex 2021 für Stadtbäume im Klimawandel sind sechs Empfehlungen zur Baumartenwahl unter Berücksichtigung der Biodiversität festgehalten:
- Baumarten mit hohen Biodiverstitätsindex pflanzen
- Alte Bäume erhalten, Ersatzpflanzungen planen
- Keine invasiven gebietsfremden Arten auf privaten Arealen und in Grünanlagen pflanzen
- Wildformen verwenden (unveredelt)
- Baumartenvielfalt gezielt fördern
- Baumumgebung naturnah planen und pflegen
Gemischte Pflanzungen führen neben einer erhöhten Vielfalt in der Fauna, auch zur Ausbremsung von Schadorganismen [10]. Neben einer Vielfalt der Arten ist in diesem Sinne auch die genetische Vielfalt innerhalb der Arten anzustreben [26].
Eine Mischung von Nadel- und Holzbäumen sollte unter diesem Gesichtspunkt in Betracht gezogen werden [27].
Baumarten auswählen
Um die passende Baumart auszuwählen, müssen mit einer Fachperson einige Fragen geklärt werden, die in den folgenden Kapiteln detaillierter beschrieben werden. Grob ist der Ablauf:
- Zielsetzung definieren (Nutzen, Funktion)
- Standort bewerten
- Mit Potenzial von Bäumen abgleichen
- Bäume in Planung einbeziehen, evtl. Szenarien mit verschiedenen Arten durchspielen
Die Ergebnisse der Standortbewertung und das Potenzial von Bäumen beeinflusst wiederum die Zielsetzung.
Naturverjüngung und Ökotypen
Als Alternative zur Pflanzung von Bäumen, sollte Naturverjüngung, also Sämlinge und Stockausschläge, in Betracht gezogen werden. Dies kann vor allem in grösseren Parkanlagen sinnvoll sein, da es zum einen Kosten spart und zum anderen eine ungestörte Wurzelentwicklung, bessere Vitalität und Stabilität der Individuen am Standort gewährleistet [28].
Regionale Ökotypen von Baumarten sind an die spezifischen Standortverhältnisse angepasst und sind somit sehr geeignet, wenn sie in der Baumschule unter standortähnlichen Bedingungen gezogen wurden [29].
Je nach Standorteigenschaften und zukünftigen klimatischen Veränderungen, kann die Verwendung regionaler Ökotypen durch die gezielte Auswahl von Provenienzen und bestimmten Baumarten ersetzt oder ergänzt werden [30]. Pionier- und Übergangsarten können sich besser auf extreme Bedingungen einstellen als Klimaxbaumarten, weshalb ihre Verwendung sinnvoll sein kann [22].
Wichtig zu beachten ist, dass an Standorten ohne extreme Umweltbedingungen, möglichst einheimische Arten verwendet werden sollten. Nicht-einheimische Arten sollten vorwiegend nur an Standorten eingesetzt werden, an denen einheimische Arten keine gute Bedingungen vorfinden (z.B. Strassenraum).
Nutzung, Funktion und Dimensionierung klären
Um zu beurteilen, inwiefern ein Parkbaum angelegt werden soll, sind die vorgesehene Nutzungen und Funktionen zu klären und mit den Potenzialen von Parkbäumen abzugleichen.
Hinsichtlich der Dimensionierung ist zu beachten, dass Baumarten ausgewählt werden, die nicht mehr als den zur Verfügung stehenden Raum in Anspruch nehmen. Nur so können Grenzabstände ohne grösseren Folgeaufwand eingehalten werden. Als grobe Orientierung kann die Unterteilung in Bäume der 1. bis 3. Ordnung dienen [25].
Grenzabstände, Abstände zu Gebäuden und Strassen (Lichtraumprofil) unterliegen kantonaler Regelung. Der durchwurzelbare Raum ist unbedingt zu berücksichtigen. Als Faustregel für den Wurzelraumbedarf werden 0.75 m3 pro 1 m3 Kronenvolumen angenommen [3]. Der Arbeitskreis Schwammstadt fordert auch in stark gestörtem Umfeld (z.B. am Parkrand) mindestens 36 m3 Wurzelraum pro Baum [31]. Alte unterirdische Bauten müssen berücksichtigt und mögliche Schutzmassnahmen geprüft werden.
Neben dem Habitus sind Blatttextur und Blüte sind ebenfalls gestalterische Planungskriterien [25][29]. Der Habitus sowie die Freiraumgestaltung beeinflussen den späteren Pflegeaufwand und somit die Kosten [32]. Schmale Kronen sind leichter zu pflegen als ausladende.
Ökologie
Lebensraum für Wildtiere und Pflanzen
Nahrung für Wildtiere
Kühlung/Schatten, Versickerung und Wasserretention, Transpiration, Luftreinigung
Beitrag Bodenschutz und Versiegelung
Beitrag Vernetzung und ökologischer Ausgleich
Gestaltung
Abgrenzung, Abstandsgrün, Zierelemente
Sicht-, Lärm- und Windschutz
Wald, Sichtachsen
Nutzung
Aktive und passive Naturerlebnisse
Verkehrs- und Besucherlenkung
Nutzung von Nüssen und Früchten
Standort wählen
Zu den standortspezifischen Bedingungen gehören derzeitige und zukünftige klimatische Verhältnisse (Sonneneinstrahlung, Temperatur, Wind, Niederschlag), die Bodeneigenschaften (Bodenbeschaffenheit, Nährstoffgehalt, pH-Wert, etc.) und weitere Faktoren (Tausalze, Immissionen, Nutzungsdruck, Hundeurin) [3][25][33].
Einige Hilfsmittel bei der Klärung der Standortansprüche verschiedener Baumarten:
- Natur braucht Stadt - Mehr Biodiversität in Bern: einheimische Gehölze
- Flora der Gehölze: einheimische und nicht-einheimische Gehölze
- Kataloge einiger Baumschulen (z.B. Wörlein, Lorenz von Ehren): einheimische und nicht-einheimische Gehölze
- Citree: einheimische und nicht-einheimische Gehölze
Bei der Wahl der Baumarten und deren Zusammensetzung kann es, vor allem auf wenig gestörten, reifen Böden, hilfreich sein vorhandene natürliche Pflanzengesellschaften nach TypoCH zu analysieren und sich hieran zu orientieren [14]. Über die so ermittelte Pflanzengesellschaft kann mithilfe eines Ökogrammes auf Bodentypen, Wasserversorgung und Nährstoffversorgung am Standort rückgeschlossen werden.
Unterpflanzung planen
Ein Baum kann sein ökologisches Potenzial optimal entfalten, wenn seine Umgebung naturnah geplant, gestaltet und gepflegt wird [35]. Nicht nur die Artenvielfalt profitiert davon, sondern auch die Gesundheit des Baumes. Naturnahe vielfältige Unterpflanzungen von Bäumen kühlen den Stammfuss und den Wurzelbereich, schützen vor Salzeintrag sowie mechanischen Schäden und wirken sich positiv auf das Bodenleben aus [36].
Förderlich für eine hohe Biodiversität ist ein mosaikartiger Strukturreichtum in der Umgebung der Bäume [24]. Boden-, Kraut-, Strauch- und Baumschicht sollten vorhanden sein und auf der Fläche in möglichst vielen Kombinationen vorkommen und so alle Ebenen erschlossen werden.
Weitere Informationen finden sich bei Strauchbepflanzung, Kleinstrukturen, Ökologische Vernetzung.
Ausführung planen
Es gilt die Stückzahl Pflanzen und die notwendigen Massnahmen zur Vorbereitung der Pflanzungen zu ermitteln. Die Vorbereitungen umfassen beispielsweise die Zufahrt, die Art des Transportes, die Vorbereitung des Bodens, sowie die Lagerung der Pflanzen.
Bäume 1. Ordnung
- Höhe: > 30 m
- Eignung: Park, grosse Gärten, Friedhof
- Platzbedarf oberirdisch: 4000 m3
- Pflanzabstände (freie Kronenentwicklung: > 15 m
Bäume 2. Ordnung
- Höhe: < 20 m
- Eignung: kleinere Plätze, Gärten, Schichtung von Parks
- Platzbedarf oberirdisch: 1500 m3
- Pflanzabstände (freie Kronenentwicklung: > 10 m
Bäume 3. Ordnung
- Höhe: < 10 m
- Eignung: Hausgarten, kleine Plätze, Schichtung von Parks
- Platzbedarf oberirdisch: 1000 m3
- Pflanzabstände (freie Kronenentwicklung): > 6 m
Für Parks empfehlen sich vor allem einmalig ballierte oder wurzelnackte Gehölze. Es gelten die Qualitätsbestimmungen von Jardin Suisse [39]. Junge Bäume passen sich besser an standortspezifische Bedingungen an und sollten bevorzugt werden [29]. Pflanzen können bei Schweizer Baumschulen und Forstbaumschulen mit Angaben zur Saatgutherkunft bestellt werden.
Ballierte und wurzelnackte Pflanzen sind im Normallfall im Herbst nach Laubfall oder im Frühling vor dem Einsetzen des Triebwachstums zu pflanzen [40].
Kosten schätzen
Erstellungskosten
Die Erstellungskosten für Parkbäume sind verhältnismässig hoch. Besonders für Hochstämme mit Ballen ab einem Stammdurchmesser von 12 bis 14 cm sind höhere Kosten einzuplanen.
Wird ein Unternehmen mit der Pflanzung beauftragt, kommen die Kosten für die Planung, Anfahrt, Pflanzung, Befestigung und Erstellungspflege hinzu. Für eine Kostenschätzung sind Offerten bei verschiedenen Unternehmen einzuholen. Dabei ist klar zu definieren, inwiefern die Erstellungs- und Entwicklungspflege der ersten Jahre ebenfalls in der Offerte enthalten sein soll. Kompetenzen in der Erstellung haben zum Beispiel Bioterra-Fachbetriebe.
Detaillierte Erstellungskoten können zum Beispiel basierend auf der Planung mit Greencycle kalkuliert werden.
Betriebs- und Unterhaltskosten
Baumpflege ist im Regelfall von Fachpersonen durchzuführen. Obstbaumschnitt ist ein Sonderfall und kann in zahlreichen Kursen erlernt werden.
Die langfristigen Unterhaltskosten können basierend auf der Planung zum Beispiel mit Greencycle light einfach ermittelt werden.
Weitere Informationen zu den Kosten und Nutzen.
Realisierung
-
Bestehende Bäume während Bauphase schützen
-
Bestellung kontrollieren: Qualität, Herkunftsnachweis, Gesundheit, Schäden
-
Verankerung ermöglicht weiterhin leichte Bewegung von Krone und Stamm
-
Während der Erstellungspflege nur bei langandauernder Trockenheit wässern, keine Düngung
-
Fachgerechter Transport und Entladung
-
Bäume in richtiger Höhe pflanzen
-
Baumscheibe begrünen
Massnahmen im Detail
Bäume transportieren
Beim Transport von Bäumen dürfen keine Pflanzenteile verletzt werden. Bei grösseren Exemplare sollte für die Entladung ein Gurt um den Wurzelballen und ein Gurt um den Stamm zur Führung befestigt werden.
Sollten die gelieferten Pflanzen länger als 48 Stunden gelagert werden, muss der Wurzelballen/die Wurzeln eingeschlagen (Planen, Strohmatten) oder mit Erde überdeckt und gewässert werden [41][42].
Die Zwischenlagerung an einem beschatteten Ort reduziert den Wasserbedarf.
Bestellung kontrollieren
Bei der Lieferung von Bäumen sollte auf eine schadensfreie Anlieferung und Einhaltung der bestellten Qualität geachtet werden [25][42].
Pflanzgrube und Pflanzung erstellen
Bei der Herstellung der Pflanzgrube gibt es zwei Szenarien.
- Das erste ist, dass der Boden für eine Baumpflanzung nicht oder nur bedingt geeignet ist und vorbereitet werden muss.
- Beim zweiten Szenario ist der Boden für eine Baumpflanzung geeignet.
In diesem Profil werden nur Pflanzgruben an geeigneten Standorten berücksichtigt. Details zu Grubenbauweisen bei nicht oder bedingt geeignetem Boden kann dem Profil Strassenbaum (in Bearbeitung) entnommen werden.
Das Pflanzloch sollte etwa die 1,5 bis 2-fache Breite und Höhe des Wurzelballens haben und an der Sohle mit dem anstehenden Boden, z.B. durch aufgestemmte Spatenstiche, verzahnt werden [25][42]. Der Aushub sollte nach Schichten getrennt gelagert und anschliessend in der richtigen Reihenfolge wieder eingebracht werden [25].
Pflanzung ausführen
Der Wurzelballen wird von Drahtgeflecht und Jute befreit [42]. Verletzte Wurzeln werden mit einer scharfen Baumschere entfernt [42].
Der Baum wird senkrecht in das Pflanzloch platziert, ausgerichtet und der Boden/das Substrat lagenweise eingebaut. Die Pflanzhöhe entspricht dem ursprünglichen Bodenniveau [42].
Es ist darauf zu achten, dass die Wurzelanläufe nach der Setzung des Bodens über der Bodenoberfläche liegen [25][42]. Danach wird ein Giessrand erstellt und gewässert. So wird der Kontakt zwischen Wurzeln und Erdreich verbessert und ein kapillarer Bruch verhindert.
Es empfiehlt sich keinen Pflanzschnitt durchzuführen, sondern mit dem Erziehungsschnitt erst im zweiten Standjahr zu beginnen [42].
Baum verankern
Bis ein ausgedehntes Wurzelsystem die Standsicherheit des neu gepflanzten Baumes gewährleistet, ist eine Verankerung nötig.
Die Verankerung ermöglicht, dass sich Krone und Stamm minimal bewegen können und kann nach 2 bis 3 Jahren entfernt werden [25][42].
Stammschutz anbringen
Einige Baumarten (z.B. Ahorn (Acer sp.), Linde (Tilia sp.)) reagieren sensibel auf plötzliche Sonneneinstrahlung, es kann zu flächigem Absterben der Rinde und Stammrissen kommen.
Als Schutz können reflektierende Anstriche (z.B. Arbo-Flex) oder schattierende Matten (z.B. Bambus) verwendet werden, die für eine Dauer von etwa 10 Jahren bleiben sollen [25][42].
Baumscheibe erstellen
Die Grösse der Baumscheibe soll mindestens 6 m2 betragen und kann bepflanzt, gemulcht oder mit freitragenden Elementen überbaut werden [25]. Eine Unterpflanzung ist für die Förderung der Biodiversität gegenüber einer Mulchung vorzuziehen.
Die Unterpflanzung kann direkt im Substrat oder mittels einer separat angebrachten Vegetationstragschicht erfolgen [25].
Bei Begrünungen mit Rasen oder anderen niedrig wachsenden Pflanzen sollte ein weiterer Schutz des Stammes und des Wurzelbereiches in Betracht gezogen werden [43]. Mäharbeiten sollten um den Baum herum nicht maschinell erfolgen, da eine Bodenverdichtung oder Stammschäden entstehen können.
Je nach Standort und Nutzung kann die Verwendung von verdichtungsresistentem Substrat oder einer technischen Abdeckung (Platten, Gitter) notwendig sein [44].
Erstellungs- und Entwicklungspflege durchfüren
Die Erstellungspflege umfasst Pflegearbeiten während 1 bis 2 Vegetationsperioden nach Abnahme der Pflanzung [45]. Zu den Massnahmen gehören die Pflege der Baumscheibe, Kontrolle der Verankerung, Entfernung von Stammaustrieben, Wässern etc. [25]. Ziel der Pflege ist das Erreichen und der Erhalt des funktionsfähigen Zustandes des Gehölzes. Der Baum soll gesund und vital sein, sowie gestalterische Aspekte erfüllen.
Der neu gepflanzte Baum ist im ersten Standjahr von April bis September zweimal monatlich, bei Bedarf auch öfter, zu wässern. Als Richtwert können bei Hochstämmen 75 bis 100 L pro Bewässerungsgang gelten. Ebenfalls sind Anbindungen zu überprüfen und, wo unbedingt nötig, trockene Pflanzenteile zu entfernen [25].
Der Schweizer Baumpflegeverband empfiehlt keine Düngung [42].
Pflege
-
Fachgerechte Schnittmasnahmen
-
Kleine Schnittflächen
-
Belassen von Totholz und Laub sofern möglich
-
Alternativen zu Schnittmassnahmen (z.B. Kronensicherung) prüfen
-
Zu starke Schnitte und Kappungen wann immer möglich vermeiden
-
Kronenschnitt nach Bedarf durchführen
-
Baumschnitt möglichst zu Beginn der Vegetationsperiode
-
Artgerechter, schonender, der natürlichen Wuchsform entsprechender Rückschnitt
-
Keine Holzschutzmittel oder Pestizide verwenden
Naturnahe Pflege
Die Baumpflege darf nur von zertifizierten Baumpfleger:innen durchgeführt werden. Aus pflanzenphysiologischen wie auch ökologischen Gründen ist neben der korrekten Pflegemassnahme auch der geeignete Zeitpunkt zu wählen. Grossbäume sind Lebensräume geschützter Tierarten. Eier, Nester, Brutstätten etc. sind zu erhalten und gemäss Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) geschützt.
Schnittmassnahmen zielen auf die Erhaltung der Sicherheit des Baumes. Dazu kann es notwendig werden Totholz zu entfernen oder Pflanzenteile bis hin zu ganzen Krone einzukürzen [9][22][46][47].
Alle Schnittmassnahmen an lebenden Ästen erhöhen das Pilz-Infektionsrisiko des Baumes. Deshalb sollen nur möglichst wenige Schnitte, mit möglichst geringer Schnittfläche, durchgeführt werden. Die Effizienz der Reaktion auf Verletzungen unterscheidet sich nach Baumart und der Vitalität des Individuums, was die maximale Schnittstärke bedingt [46].
Der Schnitt soll idealerweise bei Laubbäumen während der Vegetationsperiode durchgeführt werden, da nur während dieser Zeit eine optimale Reaktion auf die Schnitte möglich ist [48]. Im Sommer speichert der Baumorganismus Reservestoffe für die Vegetationsruhe ein.
Je früher der Schnitt vorgenommen wird, desto weniger wird dieser für alte Individuen und wenig winterharte Arten besonders wichtige physiologische Prozess gestört und desto mehr Zeit hat der Baum zur Reaktion. Des Weiteren können während der Vegetationsperiode kranke oder abgestorbene Äste besser erkannt werden. Der Schnitt sollte jedoch nicht während dem 15. März bis 15. Juli stattfinden, da ansonsten die vorhandenen Vögel und Säugetiere während der Fortpflanzungszeit gestört werden.
Bei Nadelbäumen empfiehlt sich aus Perspektive der Ausführenden wegen des starken Harzflusses im Sommer ein Winterschnitt [48].
Massnahmen naturnahe Pflege im Jahresverlauf
Es liegen keine wissenschaftlichen Untersuchungen vor, dass Wundschutzmittel die Besiedlung von Schnittstellen mit Pilzsporen und Fäulniserregern verhindern. Bei grösseren Wunden kann jedoch die Abdeckung des verletzten Kambiums zu einer verbesserten Wundreaktion führen [49]. In der Baumpflege dürfen keinerlei Holzschutzmittel verwendet werden [49][50].
Für die Pflegenden gilt es abzuwägen, ob und wann Pflegemassnahmen oder Schnitte tatsächlich nötig sind. Oftmals ist eine Abwägung zwischen Nutzersicherheit und Ökologie zu treffen [9]. Der SOLL-Zustand eines Parkbaumes ist eine möglichst extensive Pflege mit wenigen Schnitten, die dennoch die Sicherheit der Parknutzer gewährleistet. Dies kann jedoch auch durch Absperren einzelner Bereiche erreicht werden. Ausserdem muss bei der Baumpflege das Umfeld des Baumes berücksichtigt werden. So müssen Verkehrswege, Gebäude oder Laternen vom Baum unbeeinflusst bleiben.
Planungs- und Umsetzungshilfen
Der Profilkatalog naturnahe Pflege vermittelt Fachwissen und Handlungsanleitungen zu sämtlichen Profilen. Das Praxishandbuch ist eine kompakte Kurzfassung des Kataloges. Im Jahrespflegeplaner sind die Pflegemassnahmen für alle Profile in einer Excel-Tabelle zusammengestellt.
Massnahmen im Detail
Baumkontrolle durchführen
Ziel der Baumpflege ist ein vitaler, gesunder, stabiler, standortgerechter und verkehrssicherer Baumbestand [46][47]. Um Anzeichen der Beeinträchtigung aus dem Umfeld, der Vitalität des Baumes, oder anderweitigen Handlungsbedarf zur Erhaltung des Baumes bzw. dessen Stand- und Bruchsicherheit zu erkennen und entsprechende Massnahmen festzulegen, sind regelmässige Baumkontrollen durch Expert:innen notwendig.
Das jeweilige Kontrollintervall richtet sich nach der berechtigten Sicherheitserwartung des Verkehrs am Standort, dem Zustand, sowie der Entwicklungsphase (Alter) des Baumes und wird während der Kontrolle festgelegt. Bei den Baumkontrollen sollen auch Habitate und Habitatsbäume dokumentiert werden.
Bei Verdacht auf die Besiedlung des Baumes durch geschützte Arten sollte eine fachkundige Person hinzugezogen werden [51].
Kopfschnitt ausführen
Bäume können als Kopfbäume erzogen werden. Auch geschädigte Bäume können oft als Kopfbaum erhalten werden, wenn ihr Fortbestehen nicht anders gewährleistet werden kann. Kopfbäume sind ökologisch wertvoll und können bei richtiger Pflege sehr alt werden [52].
Altbäume pflegen
Die Behandlung von Altbäumen erfordert Erfahrung, Kreativität und Feingefühl, da die Aspekte des Artenschutzes und der evtl. altersbedingten Reaktionsfähigkeit verstärkt hervortreten [53]. Schnittmassnahmen sollten nur mit Begründung stattfinden [47][54].
Baumfremder Bewuchs
Es kann notwendig werden baumfremden Bewuchs, wie Efeu (Hedera helix) zu entfernen, wenn dieser die Entwicklung oder Erhaltung des Baumes beeinträchtigt. Dies ist nur äusserst selten der Fall, beispielsweise bei kleinen oder geschwächten Gehölzen.
Der Wert von Efeu für die Förderung der Biodiversität ist aufgrund der ökologischen Nischen sehr gross, daher sollte dieser in dem meisten Fällen beibehalten werden [22][47].
Baumschutz auf Baustellen sicherstellen
Bauarbeiten im Baumumfeld müssen gut geplant werden, um Schutz vor Verdichtung durch Befahren, Vergiftung, Bodenanhäufungen, Bodenabgrabungen, Vernässung, befristete Grundwasserabsenkungen und mechanischen Schäden an Wurzeln und Stamm zu gewährleisten.
Düngung
Bäume sollen nicht gedüngt werden. Wenn das Laub unter den Bäumen belassen wird, kommt es nicht zu Mangelerscheinungen.
Laub belassen
Laub sollte unter den Bäumen gelassen werden [38]. Wird es entfernt, kann es zu einer Unterversorgung mit Nährstoffen führen [47]. Zudem bietet Laub ein wichtiger Lebensraum und Unterschlupfmöglichkeiten für viele Tiere und Pilze, sodass durch eine Belassung die Biodiversität gefördert werden kann. Ausserdem können dadurch Ressourcen gespart werden.
Instandsetzung
Um die Vitalität von Parkbäumen zu verbessern, können neben Schnittmassnahmen eine Vielzahl anderer Massnahmen ausgeführt werden. Dazu gehören unter anderem die Behandlung von Rindenschäden, Faulstellen und Ausbruchstellen, sowie Kronensicherungen und eine Verbesserung des Baumumfeldes.[47].
Kronensicherung
Es können beispielsweise der Artenschutz oder die Vitalität des Baumes gegen die Herstellung der Sicherheit durch einen Schnitt sprechen. Alternativ können Kronensicherungen und Baumverankerungen verbaut werden, um einzelne, bruchgefährdete Partien oder ganze Bäume zu sichern [9][47].
Baumumfeld
Oft ist der Ursprung einer nachlassenden Vitalität im Umfeld des Baumes zu suchen. So kann der Boden versiegelt, verdichtet, schadstoffbelastet oder ausgelaugt sein (wenn das Laub nicht am Standort verbleibt). Zur Festlegung von Massnahmen sind vorgängige Bodenanalysen erforderlich. Massnahmen können Entsiegelung, Lockerung, Bodenbelüftung bis hin zum Bodenaustausch sein [47].
Sanierung
Die Sanierung eines Parkbaumes ist dann angezeigt, wenn die grundsätzlichen Standortansprüche erfüllt sind, aber dennoch das Gehölz eine unzureichende Vitalität aufweist. Andere Gründe für Sanierungen sind grossflächig auftretende Schädlinge oder Krankheiten.
Je nach Sanierungsgrund ist der Parkbaum zusammen mit dem Substrat zu entfernen. Anschliessend ist geeignetes Substrat einzubauen und wieder zu begrünen.
Entwicklung und Förderung
Handelt es sich um einen jungen Baumbestand ohne Strukturen wie Baumhöhlen, oder ist die Umgebung naturfremd gestaltet und das natürliche Nistangebot begrenzt, kann mittels Nistkästen für Vögel und Fledermäuse ein Angebot geschaffen werden. Weitere Informationen finden sich unter Kleinstrukturen.
Eine monotone Baumumgebung, sei es strukturell oder durch einseitige Pflanzungen, kann aufgewertet werden, indem die Unterpflanzung ersetzt oder durch Arten bereichert wird, und die Strukturen aufgebrochen und diversifiziert werden.
Rückbau
-
Wenn möglich Totholz belassen
-
Weiterverwendung des Holzes als Brennholz, Rinden- oder Holzschnitzel prüfen
Massnahmen im Detail
Totholz belassen
Bei zu fällenden Bäumen kann die Krone entfernt werden und der Stamm belassen werden. Dieser bietet als stehendes Totholz einen Lebensraum für eine Vielzahl von Tieren und Pilzen [9].
Totes Astmaterial soll nach Möglichkeit belassen werden, oder es können Asthaufen als Kleinstrukturen errichtet werden. Auch Nisthilfen für Wildbienen können aus dem Holz erstellt werden. Aus Stammstücken können Totholzpalisaden oder -pyramiden errichtet werden [9]
Holz weiterverwenden
Das Holz von Baumfällungen kann als Brennholz, Rinden- und Holzschnitzel verwendet werden, oder in Form von Totholz und Asthaufen eine Fläche ökologisch aufwerten.
Bestimmungen
Bäume als Sachwerte unterliegen bezüglich Eigentum und Haftung der Schweizerischen Gesetzgebung [57].
Gesetzliche und planerische Grundlagen für die Planung, Realisierung, Pflege und Rückbau (kein Anspruch auf Vollständigkeit):
- Kantonale Einführungsgesetzte zum schweizerischen Zivilgesetzbuch: Insbesondere Bestimmungen zu Höhe und Grenzabstand von Pflanzen
- Kantonale Baumschutzgesetzte und -verordnungen
Quellen
Breuste, J., Pauleit, S., Haase, D., & Sauerwein, M. (2016). Stadtökosysteme. Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/
Huser, D., & Winkler, R. (2021). Ökosystemleistungen von Zürcher Stadtbäumen—Zehn ausgewählte Baumarten unter der Lupe. Erläuterungen zur Ausstellung «Bäume in der Stadt». Grün Stadt Zürich. https://www.stadt-zuerich.ch/
Menke, P., Peters, J., Bauer, J., Rohrbach, J., Kipar, A., & Ley, K.-F. (2014). Bäume in der Stadt. Wertvolle Gestalten im öffentlichen Grün (Nr. 12/2014; S. 44 Seiten). Stiftung DIE GRÜNE STADT.
Menke, P., Thönnessen, M., Beckröge, W., Bauer, J., Schwarz, H., Gross, W., Hiemstra, J. A., Schoenmaker-van der Bijl, E., & Tonneijk, A. E. G. (2014). Bäume und Pflanzen lassen Städte atmen Schwerpunkt—Feinstaub. Stiftung DIE GRÜNE STADT. https://www.die-gruene-stadt.de/
Stadt Zürich, & Grün Stadt Zürich. (2021). Fachplanung Stadtbäume—Planungsgrundlage für die nachhaltige Entwicklung des Baumbestandes im Siedlungsgebiet. https://www.stadt-zuerich.ch/
Steiger, P., & Glauser, C. (2016). Bäume und Sträucher im Siedlungsraum. BirdLife SVS/BirdLife Schweiz.
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin. (2016). Stadtentwicklungsplan Klima—Konkret—Klimaanpassung in der Wachsenden Stadt. https://www.stadtentwicklung.berlin.de/
Gloor, S., Taucher, A., & Rauchenstein, K. (2021). Biodiversitätsindex 2021 für Stadtbäume im Klimawandel. SWILD Zürich.
Dietz, M., Dujesiefken, D., Kowol, T., Reuther, J., Rieche, T., & Wurst, C. (2019). Artenschutz und Baumpflege (2., überarbeitete und erweiterte Auflage). Haymarket Media.
Juillerat, L., & Vögeli, M. (2006). Pflege alter Bäume zum Erhalt der Totholzkäfer im Stadtgebiet. Centre Suisse de Cartographie de la Faune CSCF. http://www.bienenzukunft.ch/
Böll, S., Albrecht, R., & Mahsberg, D. (2019). Stadtklimabäume-geeignete Habitate für die urbane Insektenvielfalt? (S. 11 Seiten). Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau.
Bütler, R., Lachat, T., Krumm, F., Kraus, D., & Larrieu, L. (2020). Habitatbäume kennen, schützen und fördern. Merkblatt für die Praxis, 64, 12.
Emberger, C., Larrieu, L., & Gonin, P. (2016). Dix facteurs clés pour la diversité des espèces en forêt. Comprendre l’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP). Institut pour le développement forestier.
Heinrich, A. (2018). Unterhalt naturnaher Lebensräume im Siedlungsraum: Heimische Gehölze (S. 13). Weiterbildungszentrum Kanton Luzern.
Tschäppeler, S., & Haslinger, A. (2021). Natur braucht Stadt—Berner Praxishandbuch Biodiversität. Haupt Verlag.
Wehrli, S. (2005). Der Naturwert von eichenreichen Wäldern. In P. Bonfils, D. Horisberger, & M. Ulber (Hrsg.), Förderung der Eiche. Strategie zur Erhaltung eines Natur- und Kulturerbes der Schweiz. https://www.proquercus.org/
LWF, B. L. für W. und F.-. (2014). In und an der Eiche. https://www.waldwissen.net/
Lachat, T., Brang, P., Bolliger, M., Bollmann, K., Brändli, U.-B., Bütler, R., Herrmann, S., Schneider, O., & Wermelinger, B. (2019). Totholz im Wald—Entstehung, Bedeutung und Förderung. Merkblatt für die Praxis, 52, 12.
Spohn, M., & Spohn, R. (Hrsg.). (2016). Bäume und ihre Bewohner: Der Naturführer zum reichen Leben an Bäumen und Sträuchern (1. Aufl). Haupt.
Fachstelle Freiraummanagement ZHAW. (2010). Wert und Nutzen von Grünräumen. VSSG.
Baden-Württemberg, U. (2015). Strategie zur Anpassung an den Klimawandel in Baden-Württemberg (S. 178). https://um.baden-wuerttemberg.de/
Roloff, A., Bonn, S., Bues, C.-T., Krabel, D., Pietzarka, U., Rust, S., Stetzka, K. M., & Weiß, H. (2019). Baumpflege: Baumbiologische Grundlagen und Anwendung (3., erweiterte Auflage). Ulmer.
Albertshauser, E. M. (1985). Neue Grünflächen für die Stadt: Natur, die man sich leisten kann ; Synthese zwischen Sparzwang und Ökologie. Callwey.
Gloor, S., Bontadina, F., Moretti, M., Sattler, T., & Home, R. (2010). BiodiverCity: Biodiversität im Siedlungsraum. (S. 40 Seiten) [Ergebnisse eines Projekts]. Bundesamt für Umwelt BAFU. http://www.biodivercity.ch/
Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL). (2010). Empfehlungen für Baumpflanzungen—Teil 1: Planung, Pflanzarbeiten Pflege [1]. FLL.
Krabel, D. (2017). Bedeutung genetischer Variabilität für den Erhalt von Baumbeständen in unseren Städten. Pro Baum, 01/2017. https://neuelandschaft.de/
Ferenc, M., Sedláček, O., & Fuchs, R. (2014). How to improve urban greenspace for woodland birds: Site and local-scale determinants of bird species richness. Urban Ecosystems, 17(2), 625–640. https://doi.org/
Ruppert, O., Rothkegel, W., & Holly, L. (2014). Zielgerichtet natürlich verjüngen—Der Ausgangsbestand und der Zielbestand bestimmen das Handeln (Nr. 99; LWF aktuell). LWF. https://www.waldwissen.net/
Roloff, A. (2013). Bäume in der Stadt. Ulmer Eugen Verlag.
Roloff, A., & Kniesel, B. (2008). Waldbaumarten und ihre Verwendung im Klimawandel. Archiv für Forstwirtschaft und Landschaftsökologie, 97–109.
Arbeitskreis Schwammstadt. (2022). Das Schwammstadt-Prinzip für Bäume. Das Schwammstadt-Prinzip für Bäume. https://www.schwammstadt.at
Roloff, A. (2001). Baumkronen: Verständnis und praktische Bedeutung eines komplexen Naturphänomens. Verlag Eugen Ulmer.
Klug, P. (2016). Praxis Baumpflege - Kronenschnitt an Bäumen: Kronenschnitt entsprechend der Baumentwicklung (3., überarbeitete und erweiterte Auflage). Arbus-Verlag.
Roloff, A., Bärtels, A., & Schulz, B. (2014). Flora der Gehölze: Bestimmung, Eigenschaften und Verwendung (4., komplett aktualisierte und erweiterte Auflage). Eugen Ulmer KG.
Gloor, S., & Göldi Hofbauer, M. (2018). Der ökologische Wert von Stadtbäumen bezüglich der Biodiversität (Studie 22. Jg.; in: Jahrbuch der Baumpflege, S. 33–48). Jahrbuch der Baumpflege. http://www.swild.ch/
Heinrich, A., & Saluz, A. G. (2017). Die Logik der „Gehölzbetonten Pflanzensysteme“. 2017(3)(3), 25–30.
Tschander, B. (2014). Konzept Arten- und Lebensraumförderung. https://www.stadt-zuerich.ch/
Scholl, I. (2013). Natur findet Stadt – Naturnahe Umgebung. Stadt St.Gallen, Amt für Umwelt und Energie, Gartenbauamt, Stadtplanungsamt.
ardinSuisse. (2018). Schweizer Qualitätsbestimmungen für Baumschulpflanzen und Stauden (S. 24). https://www.jardinsuisse.ch/
Forstpflanzgarten Finsterloo. (2021). Forstpflanzgarten Finsterloo—Preisliste 20/21. Kanton Zürich Baudirektion Amt für Landschaft und Natur Abteilung Wald. https://www.zh.ch/
DIN Deutsches Institut für Normung e.V. & Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL). (2019). Fokus Baum: Von Pflanzenqualität bis Pflege und Ausschreibung (2., überarbeitete und erweiterte Auflag). Beuth Verlag.
Joos Reimer, Dr. K. (2018). Bäume pflanzen – aber richtig. Bund Schweizer Baumpflege. Schönenbachstrasse 45, 4153 Reinach.
Grossfurtner, I., & Florineth, F. (2012). Baumscheibengestaltung im Stadtgebiet von Mödling—Auswirkungen von Bewuchs auf Straßenbäume [Master, Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau Department für Bautechnik und Naturgefahren Universität für Bodenkultur Wien]. https://epub.boku.ac.at/
Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL). (2010). Empfehlungen für Baumpflanzungen – Teil 2: Standortvorbereitungen für Neupflanzungen; Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, Bauweisen und Substrate (Broschüre 2 Ausgabe; Baumpflanzungen, S. 64 Seiten). FLL. https://shop.fll.de/
Grün Stadt Zürich. (2016). Spezielle Bedingungen von Grün Stadt Zürich (GSZ). Grün Stadt Zürich. https://www.stadt-zuerich.ch/
Erb, M. (2011). Baumschnittrichtlinien. Stadtgärtnerei Basel-Stadt. http://www.stadtgaertnerei.bs.ch/
Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL). (2017). ZTV-Baumpflege—Zusätzliche Vertragsbedingungen und Richtlinien für Baumpflege. FLL.
Joos Reimer, Dr. K. (2018). Sommerschnitt kontra Winterschnitt an Bäumen—Vor- und Nachteile der verschiedenen Schnittzeiten. Bund Schweizer Baumpflege. https://baumpflege-schweiz.ch/
Dujesiefken, D. (2012). Die Häufigsten Irrtümer im Umgang mit Bäumen in der Baumpflege. Institut für Baumpflege, bund Mecklenburg Vorpommern. https://www.bund-mecklenburg-vorpommern.de/
Siewniak, M., & Kusche, D. (2009). Baumpflege heute ([5., überarb. Aufl.]). Patzer.
Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL). (2020). Baumkontrollrichtlinien—Richtlinien für Baumkontrollen zur Überprüfung der Verkehrssicherheit. FLL. www.fll.de
StMLU, & ANL. (1995). Landschaftspflegekonzept Bayern—Lebensraumtyp Einzelbäume und Baumgruppen. Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen/Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege. https://www.anl.bayern.de/
Winkler, M. (2018). Denkmalgerechte Baumpflege an Altbäumen. Baumpflegeportal. https://www.baumpflegeportal.de/
Fay, N. (2015). Der richtige Umgang mit uralten Bäumen. Jahrbuch der Baumpflege, 181–197.
Heinrich, A., Derman-Baumgartner, C., & de Roos, A. (2021). Florale Biodiversitätsförderung auf Grünflächen des Bundes 2016–2020. ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL). (2005). ZTV-Großbaumverpflanzung – Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für das Verpflanzen von Großbäumen und Großsträuchern (S. 36 Seite) [Broschüre]. FLL.
Bund Schweizer Baumpflege. (2022). DOKUMENTE | Bund Schweizer Baumpflege. https://baumpflege-schweiz.ch/