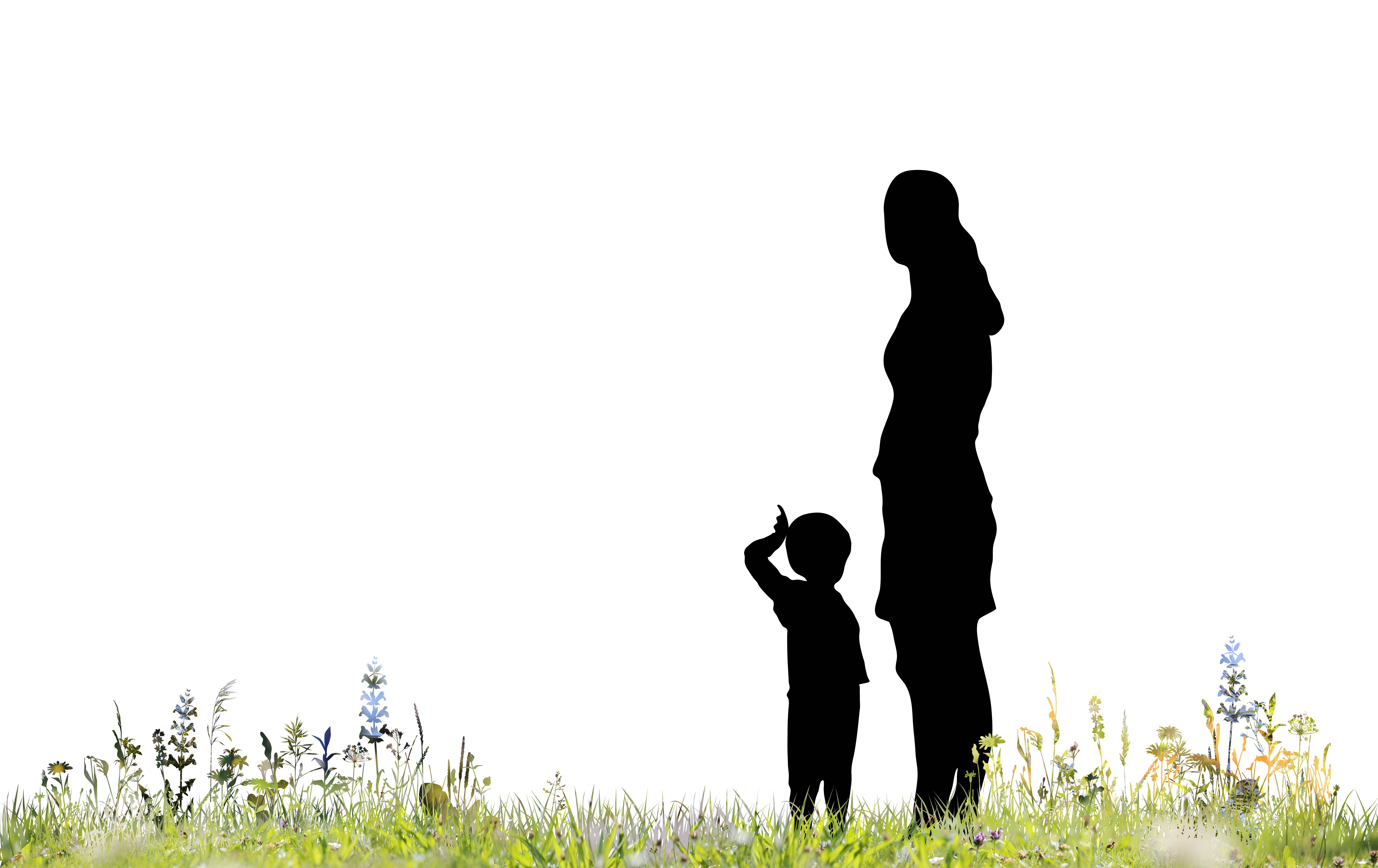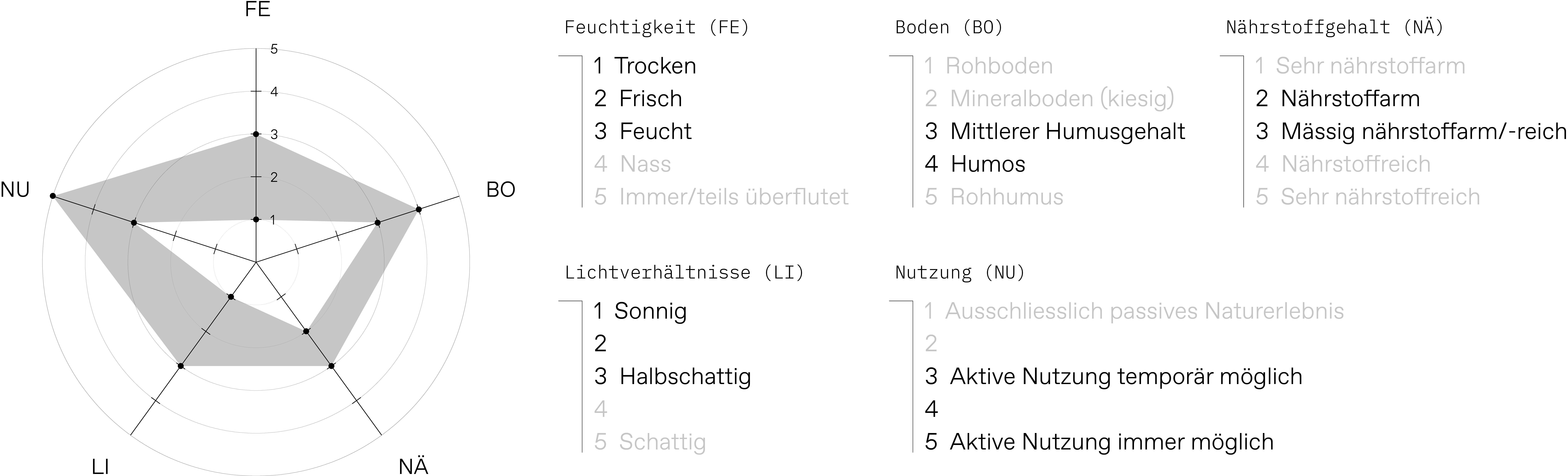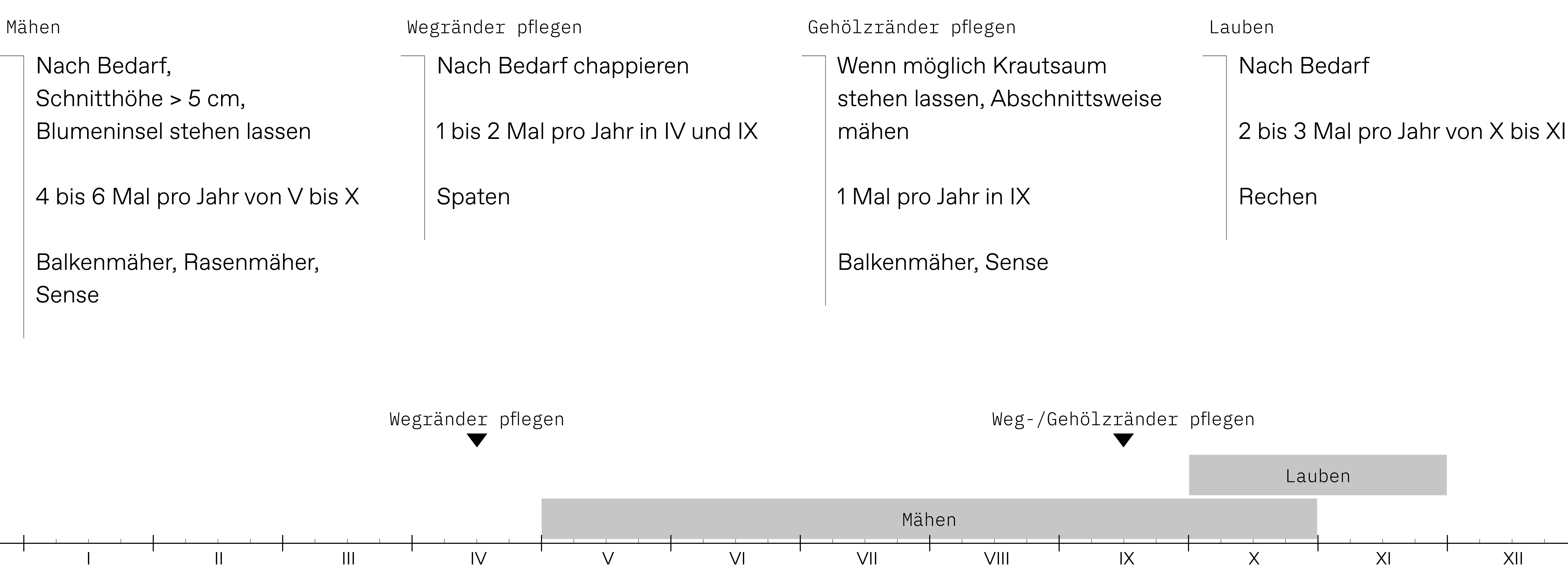In Kürze
Blumenrasen enthalten mehr blühende Wildpflanzen als Gebrauchsrasen, vermitteln durch die regelmässige Mahd aber dennoch einen gepflegten, ordentlichen Eindruck.
Kurzdefinition
Blumenrasen sind die Zwischenformen zwischen einem niedrigwachsenden Gebrauchsrasen und einer hochwüchsigen, artenreichen Blumenwiese. Blumenrasen bestehen aus schnittverträglichen, regenerationsfähigen und vorwiegend einheimischen Wildgräser und -stauden. Blumenrasen eignen sich auch für begeh- und nutzbare Flächen und Randbereiche von Blumenwiesen.
Biodiversitätsförderung
Wird das Profil wie auf dieser Seite beschrieben geplant, realisiert und gepflegt, weist es folgende Potenziale auf:
hoch = • • • • • tief = • negativ = (•)
Ökologische Vernetzung
• •
Lebensraum für Wildtiere
• •
Lebensraum für Wildpflanzen
• •
Ökologischer Ausgleich
• •
Anforderungen
Grundsätze
Mit der Erfüllung dieser Grundsätze wird die Biodiversität gefördert.
Saat- und Pflanzgut
100% einheimisch und standortgerecht
> 20% Wildstaudenanteil, < 80% Gräseranteil
Möglichst autochthon
Hohe Artenvielfalt
0% invasive gebietsfremde Arten
Pflege
Möglichst gesamte Fläche gemäss Prinzipien naturnahe Pflege
4 bis 6 Mal pro Jahr mähen
> 5 cm Schnitthöhe
Blumeninseln
Nutzung
Extensive Nutzung
Standort
Halbschattig bis sonnig
Erhöhte Anforderungen
Mit der Erfüllung dieser erhöhten Anforderungen wird die Biodiversität noch stärker gefördert.
Saat- und Pflanzgut
Nur Wild- und keine Zuchtformen
Potenzial regionaler Spenderflächen nutzen
Mindestgrösse
> 10 m2
Pflege
100% der Fläche gemäss Prinzipien naturnahe Pflege
Faktenblatt
Das Wichtigste ist in diesem Faktenblatt zusammengesellt.
Definition
Blumenrasen sind die Zwischenformen zwischen einem niedrigwachsenden Gebrauchsrasen und einer hochwüchsigen, artenreichen Blumenwiese. Blumenrasen bestehen aus schnittverträglichen, regenerationsfähigen und vorwiegend einheimischen Wildgräsern und -stauden.
Die Pflanzenarten sind anspruchslos und trittverträglich. Blumenrasen eignen sich auch für begeh- und nutzbare Flächen und Randbereiche von Blumenwiesen (Sauberkeitsstreifen).
Die Wuchshöhe der Pflanzen beträgt maximal 15 cm (in Ausnahmefällen 30 cm). Im Gegensatz zum Gebrauchsrasen zeichnen sich Blumenrasen durch einen wesentlich höheren Anteil an Wildstauden sowie einen etwas höheren Wuchs aus [1]. Der Unterschied zur Blumenwiese besteht vor allem im niedrigeren Wuchs und dem geringeren Anteil an Blütenpflanzen.
Potenzial
Wird das Profil wie auf dieser Seite beschrieben geplant, realisiert und gepflegt, weist es folgende Potenziale auf:
hoch = • • • • • tief = • negativ = (•)
Ökologische Vernetzung
• •
Lebensraum für Wildtiere
• •
Lebensraum für Wildpflanzen
• •
Ökologischer Ausgleich
• •
Hitzeminderung
• •
Verbesserung Luftqualität
• •
Versickerung und Wasserretention
• • •
Bodenschutz und Versiegelung
• • •
aktive Nutzung
• • • •
passive Nutzung und Aufenthaltsqualität
• • •
Nutzung, Gestaltung und ökologisches Potenzial
Blumenrasen sind im Siedlungsgebiet auf regelmässig gemähten, extensiv genutzten Rasenflächen zu finden. In älteren Parkanlagen, Friedhöfen oder Villengärten kann sich im Verlaufe von mehreren Jahrzehnten ein Blumenrasen bilden, vorausgesetzt, er wird nicht gewässert, gedüngt oder mit Bioziden behandelt. Diese «alten» Blumenrasen sind nach Möglichkeit zu erhalten, da sich stabile, an den Standort angepasste, Pflanzengesellschaften etabliert haben [1].
Blumenrasen enthalten mehr blühende Wildpflanzen als Gebrauchsrasen, vermitteln durch die regelmässige Mahd aber dennoch einen gepflegten, ordentlichen Eindruck.
Das ökologische Potenzial von Blumenrasen ist geringer als dasjenige von Blumenwiesen, jedoch wesentlich höher als von Gebrauchsrasen. Blumenrasen können sich zu einer artenreichen Vegetation entwickeln, welche Nahrungsangebote und Lebensraum für zahlreiche Tierarten bietet.
Die Flächen dürfen bei trockenen Verhältnissen betreten werden. Allerdings ist die Belastbarkeit geringer als bei Gebrauchsrasen und entspricht in etwa einem mittelstark genutzten Gebrauchsrasen. Extensive Nutzungen wie Liegen und gelegentliches Spiel sind möglich und beeinträchtigen den Blumenrasen kaum. Für eine dauerhafte intensive Nutzung sind Blumenrasen jedoch nicht geeignet [2].
Blumenrasen können dank ihrer höheren Nutzbarkeit im innerstädtischen Bereich auch eine Alternative zu einer Blumenwiese sein [1]. Sie eignen sich ebenfalls für Randbereiche von Blumenwiesen (Sauberkeitsstreifen).
Typische Pflanzen
Blumenrasen bestehen aus schnittverträglichen, regenerationsfähigen und vorwiegend einheimischen Wildgräsern und -stauden. Typische Pflanzen von Blumenrasen sind vor allem konkurrenzschwache und eher langsam wüchsige Wildgräser und kriechende Wildstauden mit einer hohen Blütenintensität, die eine regelmässige Mahd vertragen [3].
Bei einem naturnahen Pflegeregime (z.B. 5 bis 6 Schnitte pro Jahr, keine Düngung) können sich Arten der Fromentalwiesen und teilweise auch der Trespen-Halbtrockenrasen etablieren und reproduzieren [4].
Pflanzenarten von Blumenrasen sind grundsätzlich anspruchslos und bei guter Witterung trittverträglich. Ein Blumenrasen beinhaltet bis zu 25 verschiedene Pflanzenarten [2]. In alten Beständen können auch einheimische Orchideen vorkommen [1].
Beispiele Pflanzenarten
Mit diesem Profil können zum Beispiel folgende Pflanzenarten gefördert werden:
Stauden
Wiesen-Schafgarbe (Achillea millefolium), Wiesen-Pippau (Crepis biennis), Gewöhnliches Labkraut (Galium verum), Kleines Habichtskraut (Hieracium pilosella), Gewöhnlicher Breit-Wegerich (Plantago major), Gewöhnliche Braunelle (Prunella vulgaris), Knolliger Hahnenfuss (Ranunculus bulbosus), Arznei-Thymian (Thymus serpyllum aggr.), Gamander-Ehrenpreis (Veronica chamaedrys), Gänseblümchen (Bellis perennis)
Gräser
Ruchgras (Anthoxanthum odoratum), Kammgras (Cynosurus cristatus), Harter Schafschwingel (Festuca ovina aggr.), Englisches Raigras (Lolium perenne), Rispengräser (Poa sp.), Rot-Schwingel (Festuca rubra)
Unter infoflora.ch sind sämtliche Arten dieses Profils bzw. Lebensraumes zu finden.
Problempflanzen
In diesem Profil sind insbesondere folgende Problempflanzen zu erwarten:
Pflanzen, die an gewissen Standorten / zu gewissen Zeitpunkten unerwünscht sind
Gewöhnlicher Löwenzahn (Taraxacum officinale), Weiss-Klee (Trifolium repens)
Typische Tiere
Ein artenreicher Blumenrasen bietet zahlreichen Tieren Lebensräume und Nahrungsangebote. Meist handelt es sich bei Blumenrasen um Teillebensräume, dies bedeutet, dass viele Tierarten weitere Lebensräume benötigen, die biodivers gestaltet sind.
Beispiele Tierarten
Typische Tiere, die mit diesem Profil gefördert werden können:
Vögel
Amsel (Turdus merula), Türkentaube (Streptopelia decaocto), Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros), Elster (Pica pica)
Säugetiere
Braunbrustigel (Erinaceus europaeus), Hausspitzmaus (Crocidura russula), Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii), Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), Rötelmaus (Myodes glareolus)
Reptilien
Blindschleiche (Anguis fragilis)
Schmetterlinge
Tagpfauenauge (Aglais io), Kleiner Fuchs (Aglais urticae), Schachbrettfalter (Melanargia galathea), Schwalbenschwanz (Papilio machaon), Grünaderweissling (Pieris napi), Hauhechelbläuling (Polyommatus icarus), Admiral (Vanessa atalanta), Distelfalter (Vanessa cardui)
Heuschrecken
Nachtigall-Grashüpfer (Chorthippus biguttulus), Gemeiner Grashüpfer (Chorthippus parallelus), Feldgrille (Gryllus campestris), Roesels Beissschrecke (Metrioptera roeselli), Grünes Heupferd (Tettigonia viridissima)
Wildbienen
Gartenhummel (Bombus hortorum), Ackerhummel (Bombus pascuorum), Wiesenhummel (Bombus pratorum), Dunkle Erdhummel (Bombus terrestris)
Standort
Blumenrasen gedeihen auf unterschiedlichen Böden an trockenen bis feuchten, nährstoffarmen bis mässig nährstoffreichen oder lehmigen Standorten. Sie bevorzugen jedoch tiefgründige und humose Böden und sonnige bis halbschattige Lichtverhältnisse [5]. Die artenreichsten Blumenrasen gedeihen auf mageren, nährstoffarmen Böden bei guter Besonnung [6].
Zielbild
Die Wuchshöhe von Blumenrasen beträgt 15 bis 20 cm (Schnitthöhe > 5 cm) und liegt damit zwischen einem niedrigwachsenden Gebrauchsrasen und einer hochwüchsigen Blumenwiese. Wenig genutzte Rand- und flächig verteilte Bereiche (Blumeninseln) können auch höher werden, indem sie seltener gemäht werden. Diese Bereiche stellen Rückzugsorte und Nahrungsquellen für verschiedene Tierarten dar.
Im Gegensatz zum Gebrauchsrasen zeichnen sich Blumenrasen durch einen höheren Anteil an Blütenpflanzen sowie einem höheren Wuchs aus. Ein artenreicher Blumenrasen besteht aus bis zu 25 verschiedenen Pflanzenarten. Der Unterschied zur Blumenwiese besteht vor allem im niedrigeren Wuchs, dem geringeren Anteil an Blütenpflanzen und dem Fehlen von Lücken am Boden.
Beispiele
Sammlung von Beispielen, die im Siedlungsgebiet von Schweizer Gemeinden und Städten angelegt wurden.
Planung
-
Bestehende ökologisch wertvolle Blumenrasen erhalten
-
Blumenrasen insbesondere an halbschattigen bis sonnigen Standorten vorsehen
-
Fläche mit einheimischen und standortgerechten Pflanzen ansäen
-
Blumenrasen extensiv nutzen
-
Ideale Standortverhältnisse schaffen
-
Naturnahe Pflegeprofile in unmittelbarer Umgebung vorsehen
-
Als Substrat nach Möglichkeit vorhandenen Oberboden nutzen
-
Pflege von Beginn an mitberücksichtigen
Massnahmen im Detail
Blumenrasen erhalten
Alte und artenreiche Blumenrasen sind wertvolle Grünraumelemente und Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Wenn immer möglich, sollen bestehende, artenreiche Rasen erhalten bleiben. Sie sind in Planungen von Umgestaltungen und Neubauten von Beginn an zu integrieren.
Bleibt der Standort bestehen, ist im Rahmen der Realisierung mittels Kommunikationsmassnahmen und Absperrungen dafür zu sorgen, dass die Rasenfläche von den Baumassnahmen unberührt bleibt.
Ist im Rahmen einer Umgestaltung ein Blumenrasen an einem anderen Standort im Projektperimeter (Baufeld, Parzelle o.ä.) vorgesehen, ist der Transfer des bestehenden Rasens an den gewünschten Ort mittels Sodenversetzung zu prüfen. Dieser Transfer muss frühzeitig geplant werden, da die Lagerung und die Austrocknung der Soden problematisch sein können. Ein solcher Transfer ist grundsätzlich auch für andere Bauprojekte in der Nähe und mit vergleichbaren Standortbedingungen möglich. Die Begrünung der neuen Flächen erfolgt in Kombination mit einer Ansaat, wobei sich die Pflanzen des Blumenrasen-Ziegels im Laufe der Zeit auf der restlichen Fläche ausbreiten.
Nutzung, Funktion und Dimensionierung klären
Um zu beurteilen, inwiefern und in welcher Dimension und Grösse ein Blumenrasen angelegt werden soll, sind die vorgesehene Nutzungen und Funktionen zu klären und mit den Potenzialen von Blumenrasen abzugleichen.
Ökologie
Beitrag an den ökologischen Ausgleich
Lebensraum für Tiere und Pflanzen
Beitrag Versickerung und Wasserretention
Beitrag Bodenschutz und Versiegelung
Gestaltung
Wilderes Erscheinungsbild und höhere Dynamik als Gebrauchsrasen
Strukturierteres Erscheinungsbild und geringere Dynamik als Blumenwiese
Restflächen, Abstandsflächen, fliessender Raum
Sauberkeitsstreifen von Blumenwiesen, Wege durch Blumenwiese
Randbereiche und weniger genutzte Bereiche von Gebrauchsrasen
Nutzung
Intensivere Nutzungsmöglichkeiten als Blumenwiese, begehbar
Extensivere Nutzungsmöglichkeiten als Gebrauchsrasen
Naturnahe Spiel- und Sportmöglichkeiten (temporär, extensiv)
Aktive und passive Naturerlebnisse (temporär und extensiv)
Standort wählen
Um zu prüfen, ob sich der Standort für einen Blumenrasen eignet, gilt es die Standortverhältnisse vor Ort zu bestimmen und mit den Standortansprüchen sowie den vorgesehenen Nutzungs- und Gestaltungsansprüchen abzugleichen [7]. In vielen Fällen ist eine genauere Standortanalyse zu empfehlen.
Blumenrasen entwickeln sich bei halbschattigen und sonnigen Verhältnissen [8] und wachsen grundsätzlich an den Standorten, an welchen auch Gebrauchsrasen gedeihen. Nur für Flächen, die vollumfänglich im Schatten liegen, eignen sich Blumenrasen nicht [5]. Auf trockenen, wasserdurchlässigen und mässig nährstoffreichen Böden an sonnigen Lagen entwickeln sich die attraktivsten und artenreichsten Vegetationen. Grundsätzlich wachsen Blumenrasen jedoch auch auf mageren und nährstoffreichen Böden [5].
Idealerweise werden Blumenrasen auf sandig-steinigem Untergrund mit einem mittleren Humusgehalt erstellt. Der Untergrund muss gut wasserdurchlässig sein, damit Regenwasser versickern kann. Pflanzen an nährstoffarmen Standorten sind schwachwüchsig. Dadurch kann der Pflegeaufwand reduziert werden [9]. An trockenen und mageren Standorten blühen zwar mehr Pflanzen, hingegen ist dort die Vegetation lückig und weniger trittfest.
Der ökologische Wert eines Blumenrasens wird gefördert, indem sich dieser in unmittelbarer Nähe von naturnahen Profilen befindet, wie zum Beispiel Blumenwiese, Wildhecke oder Trockenmauer. Auf diese Weise dienen Blumenrasen zahlreichen Tieren für die Jagd (z.B. Igel, Blindschleiche) und als Nahrungsquelle (z.B. Wildbienen, Schmetterlinge). Bei Neuanlagen und Umgestaltungen ist die Lage von Blumenrasen entsprechend auf andere Profile abzustimmen.
Wenn verdichtete Bodenschichten nicht nur lokal durch die Bautätigkeit verursacht wurden, sondern geologisch gegeben sind, bringt eine Auflockerung des Bodens kaum Erfolg. In diesen Fällen ist eine Drainage einzubauen oder unter Umständen auf (Blumen-)Rasen zu verzichten und stattdessen z.B. die Anlage einer feuchten Blumenwiese, einer Hochstaudenflur oder einer Staudenbepflanzung mit Arten mit hohem Wasserbedarf zu prüfen [3].
Blumenrasen in Blumenwiese umwandeln
Je nach Nutzungs- und Gestaltungsabsichten sind bestehende Blumenrasen durch pflegerische Eingriffe langfristig zu erhalten. Wird – mit oder ohne Absicht – auf adäquate Pflegeeingriffe verzichtet, entwickelt sich ein Blumenrasen potenziell in Richtung einer Blumenwiese. Dieser Prozess soll gezielt geplant und gesteuert und auf die ökologischen Ziele sowie Nutzungs- und Gestaltungsansprüche abgestimmt werden.
Blumenwiesen können nur extensiv genutzt werden. Vor der Umwandlung eines Blumenrasens in eine Blumenwiese sind deshalb die Nutzungsansprüche an die Fläche zu prüfen.
Wird nur die Häufigkeit des Mähens angepasst, entwickelt sich aus einem Blumenrasen meist eine relativ artenarme Blumenwiese. Hinweise zur Planung, Realisierung und Pflege einer artenreichen Blumenwiese sind im Profil Blumenwiese umfassend beschrieben.
Gebrauchsrasen in Blumenrasen umwandeln
Bestehende Gebrauchsrasen können – bei passenden Standortbedingungen – in Blumenrasen umgewandelt werden. Es bieten sich verschiedene Möglichkeiten an, wobei der Erfolg jeweils stark davon abhängt, wie konkurrenzstark die Arten der bestehenden Gebrauchsrasenfläche sind [3].
Extensivierung Pflege [8]
- Durch eine Extensivierung der Pflege können Gebrauchsrasen in einen Blumenrasen überführt werden. Hierfür die Schnitthäufigkeit reduzieren, die Schnitthöhe (>5 cm) erhöhen, Pflanzen absamen lassen und auf Düngergaben und Herbizide verzichten.
- Zeithorizont: Sichtbare Ergebnisse werden erst nach Jahren erzielt. Umwandlung lässt sich durch eine Kombination mit den Massnahmen zur Verbesserung Standortverhältnisse und Neusaat, Sodenversetzung und Übersaat beschleunigen.
Verbesserung Standortverhältnisse und Neusaat [9]
- Für die erfolgversprechendste, aber auch aufwändigste Umwandlung wird die bestehende Rasennarbe stellenweise mit einem Spaten oder bei grösseren Flächen mit einem Rasenschäler entfernt. Anschliessend wird die Fläche gefräst. Um die Boden- und Standortverhältnisse zu verbessern, kann zusätzlich Sand und/oder grobkörniger Kies eingefräst werden. Anschliessend das Saatbett vorbereiten und ansäen. Die Pflanzen breiten sich von diesen Teilflächen auf die Gesamtfläche aus. Dadurch kann die Pflanzenvielfalt erhöht und gezielter gesteuert werden. Je grösser die Fläche, von denen sich die Samen ausbreiten können, desto grösser sind die Erfolgschancen. Auf kleineren Flächen Schnecken bekämpfen.
- Zeithorizont: Ergebnisse sind ab dem zweiten Jahr sichtbar. Umwandlung lässt sich durch eine Kombination mit den Massnahmen Extensivierung Pflege auf gesamter Fläche und Übersaat beschleunigen.
Sodenversetzung, Blumenrasen-Matten [3]
- Entfernung der bestehenden Rasennarbe an gewünschten Stellen. Einsetzen von artenreichen Blumenrasen-Ziegeln (Transfer von bestehenden Blumenrasen von vergleichbaren Standorten) oder Blumenrasen-Matten aus dem Handel auf den vorbereiteten Stellen. Ziegel/Matten mit Mulchschicht aus Sand, Splitt oder Kies befestigen. Massnahme ist für grössere Flächen nicht geeignet.
- Zeithorizont: Ergebnisse sind nach Versetzung sichtbar. Umwandlung lässt sich durch eine Kombination mit den Massnahmen Extensivierung Pflege auf gesamter Fläche und Übersaat beschleunigen.
Übersaat [8]
- Rasenflächen an Wegrändern, Kuppen, Böschungen und lückigen Stellen mit konkurrenzfähigen Arten (z.B. Gundelrebe (Glechoma hederacea), Kriechender Günsel (Ajuga reptans)) einsäen. Vor der Einsaat, idealerweise im Frühjahr oder Herbst, wird der Rasen kurz geschnitten, um den ausgebrachten Samen gute Lichtverhältnisse für die Keimung zu verschaffen.
- Zeithorizont: Erste Ergebnisse ab dem zweiten Jahr sichtbar. Umwandlung lässt sich durch eine Kombination mit Massnahme Extensivierung Pflege auf gesamter Fläche beschleunigen.
Initialbepflanzung [3]
- An verschiedenen Stellen verteilt über die gesamte Fläche jeweils mindesten 1 m2 Grasnarbe entfernen. Wildstauden (8 bis 10 Stück/m2) in Gruppen pflanzen. Bei kleinen Flächen (1 m2) nur eine Art verwenden, damit mehr Samen gebildete werden. Ausbreitungsstarke Arten bevorzugen: z.B. Wiesen-Schafgarbe (Achillea millefolium), Hornklee (Lotus corniculatus), Oregano (Origanum vulgare), Gewöhnliche Braunelle (Prunella vulgaris), Gamander-Ehrenpreis (Veronica chamaedrys), Magerwiesen-Margerite (Leucanthemum vulgare). Im ersten Jahr wie Staudenbepflanzung pflegen. Beikraut und Gräser jäten, kein Rasenmäher/Sense/Balkenmäher. In den Folgejahren erfolgt die Pflege wie bei einem Blumenrasen.
- Zeithorizont: Ergebnisse sind sofort nach Pflanzung sichtbar. Umwandlung lässt sich durch eine Kombination mit Massnahme Extensivierung Pflege auf gesamter Fläche beschleunigen.
Blumenrasen in Übergangsbereichen
Blumenrasen können als Übergänge zwischen Wegen und Blumenwiesen eingesetzt werden. Dabei können sie die Funktion von Sauberkeitsstreifen übernehmen. Durch eine erhöhte Schnitthäufigkeit in den gewünschten Bereichen etabliert sich dort aus der angesäten Blumenwiese ein Blumenrasen. Die Sauberkeitsstreifen können aber auch bereits von Anfang an als Blumenrasen erstellt, angesät und entsprechend gepflegt werden.
Material auswählen
Blumenrasen können auf geeigneten Oberböden angelegt werden. Falls erforderlich, sind die Standort- und Bodenverhältnisse mit der Einarbeitung von zusätzlichen Materialen zu verbessern. Um die Tragfähigkeit eines Blumenrasens zu erhöhen, sind insbesondere auf verdichtungsempfindlichen Böden mindesten 100 Liter Sand/m2 (10 cm) einzuarbeiten [3].
Nährstoffärmere Verhältnisse können durch das Mischen des Oberbodens mit Unterboden oder durch die Einarbeitung von mineralischen Materialien (Sand, Schotter) erreicht werden. Je nährstoffärmer der Oberboden und je geringer die Wasserspeicherfähigkeit ist, desto langsamer entwickelt sich die Vegetation. Die geringe Wüchsigkeit auf nährstoffarmen Böden beeinflusst die Artenvielfalt und die notwendige Schnitthäufigkeit grundsätzlich positiv.
Falls der vorgesehene Standort über keinen geeigneten Oberboden verfügt, ist zu prüfen, ob solcher an anderer Stelle im Bauprojekt anfällt (z.B. bei der Erstellung einer Ruderalvegetation) und verwendet werden kann; Voraussetzung ist, dass der Oberboden richtig zwischengelagert wird. Alternativ kann ein adäquates Substrat lokal beschafft und eingebaut werden. Grundsätzlich ist für Blumenrasen 5 bis 20 cm Oberboden notwendig [7][10].
Begrünung planen
Die Begrünung erfolgt durch eine Ansaat mit einer artenreichen, lokalen und standortangepassten Blumenrasensamenmischung. Weitere Begrünungsvarianten sind Kombinationen einer Ansaat mit einer Initialbepflanzung oder Sodenversetzung.
Geophyten vorsehen
Um bereits im zeitigen Frühjahr einen besonderen Gestaltungseffekt zu erzielen, können Blumenzwiebeln wie etwa Märzenbecher (Leucojum vernum), Schneeglöckchen (Galanthus nivalis) oder Zweiblättriger-Blaustern (Scilla bifolia) im Blumenrasen versenkt werden [8]. Da diese Pflanzen nicht vor der Samenreife gemäht werden sollten, sind diese in den Randbereichen oder als Inseln zu setzen, die bei der Mahd ausgespart werden können [8].
Ausführung planen
Vor der Ausführung und Realisierung ist zu planen, wie die Arbeiten ausgeführt und die Materialmengen transportiert werden sollen: Von Hand (z.B. Spaten, Schubkarre) oder mit Maschineneinsatz (z.B. Rasenschäler, Dumper). Weiter sind die Zufahrten für Maschineneinsatz und Transport zu klären und zu berücksichtigen.
Die Ausführung und Erstellung können basierend auf der Planung ausgeschrieben und an ein Unternehmen vergeben werden. Die Leistungsausschreibung ist neben Massangaben auch mit Qualitätsvorgaben zu versehen. Die in dieser Web App vorhandenen Grundlagen (z.B. Referenzbilder, qualitative und quantitative Anforderungen) können hierfür genutzt werden.
Bauherrschaft aufklären
Blumenrasenansaaten entwickeln sich langsamer als angesäte Gebrauchsrasen, da die enthaltenen Arten konkurrenzschwächer sind und weniger schnell wachsen [5]. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, damit sich die Wildstauden etablieren und im Rasen bestehen können [5]. Bis sich das gewünschte Vegetationsbild einstellt, kann es folglich einige Jahre dauern, was in der Kommunikation mit der Bauherrschaft zu berücksichtigen ist.
Kosten schätzen
Erstellungskosten
Die Erstellungskosten eines Blumenrasens sind im Vergleich zu einem Gebrauchsrasen leicht höher. Insbesondere sind die Kosten für Blumenrasensaatgut höher als für Gebrauchsrasenmischungen [11].
Die Erstellungskosten sind abhängig von Grösse und Topografie der Fläche und den Personal- und Materialkosten, Pauschalen für Anfahrt und Baustellenvorbereitung und -installation sowie Kosten für Maschinen, Materialabtransport und Deponiekosten. Für eine Kostenschätzung sind Offerten bei verschiedenen Unternehmen einzuholen. Dabei ist klar zu definieren, inwiefern die Erstellungs- und Entwicklungspflege der ersten Jahre ebenfalls in der Offerte enthalten sein soll. Kompetenzen in der Erstellung von Blumenrasen haben zum Beispiel Bioterra-Fachbetriebe.
Betriebs- und Unterhaltskosten
Blumenrasen sind äusserst pflegeleicht, die Betriebs- und Unterhaltskosten entsprechend gering. Gegenüber einem Gebrauchsrasen ist ein Blumenrasen weniger zu mähen, weshalb die Pflegekosten entsprechend geringer ausfallen [12].
Die langfristigen Unterhaltskosten können basierend auf der Planung zum Beispiel mit den Kennzahlen der VSSG ermittelt werden.
Weitere Informationen zu den Kosten und Nutzen.
Realisierung
-
Bestehende Blumenrasen vor Bautätigkeiten schützen
-
Vor Ansaat aufkommende Pflanzen manuell oder maschinell entfernen, für unkrautfreien Boden sorgen
-
Ansaat von April bis Mitte Juni, danach nicht bewässern und düngen
-
Säuberungsschnitte im Aussaatjahr
-
Nach Bodenvorbereitung Boden > 4 Wochen absetzten lassen
-
Blumenrasensaatgut mit einheimischen und standortgerechten Pflanzen verwenden
-
Gleichmässige kreuzweise Ausbringung des Saatgutes, anschliessend anklopfen oder walzen
Massnahmen im Detail
Bestehende Blumenrasen schützen
Soll im Projektperimeter ein bestehender Blumenrasen erhalten bleiben, sind sämtliche Akteure auf der Baustelle umfassend zu informieren. Die Fläche ist abzusperren, damit sie von den Baumassnahmen unberührt bleibt.
Boden vorbereiten
Zunächst ist sicherzustellen, dass Regenwasser gut versickern und Bodenwasser in Trockenzeiten kapillar aufsteigen kann [3]. Hierfür ist zu gewährleisten, dass im Untergrund keine verdichteten Bodenhorizonte (z.B. durch Bauarbeiten) vorhanden sind. Allfällige Verdichtungen sind mit Bodenbohrer oder Bagger aufzulockern, um die Gefahr von Staunässe zu reduzieren [3].
Ist der vorhandene Oberboden zu nährstoffreich, können nährstoffärmere Verhältnisse geschaffen werden, indem Ober- mit Unterboden vermischt wird oder mineralische Materialien (Sand, Schotter) eingearbeitet werden. Durch eine Aufkalkung des Bodens kann einem sauren Milieu entgegengewirkt werden.
Verfügt der vorgesehene Standort über keinen geeigneten Oberboden ist ein solcher (5 bis 20 cm) einzubauen. Stammt dieser Oberboden von einer anderen Stelle im Bauprojekt, ist für eine korrekte Zwischenlagerung zu sorgen. Alternativ ist ein adäquates Substrat lokal zu beschaffen und einzubauen.
Das Saatbeet eines Blumenrasens muss gut vorbereitet werden und frei von jedem Fremdbewuchs sein. Ungefähr vier Wochen vor der Ansaat muss der Standort mit einer Bodenfräse bearbeitet werden. Alte Grasnarben gilt es restlos abzutragen. Wird die Rohplanie im Sommer oder Winter erstellt, keimen bis zur Ansaat im Herbst oder Frühling unerwünschte Pflanzen. Diese Pflanzen sind vor der Ansaat manuell oder mechanisch zu entfernen. Auf den Einsatz von Herbiziden und thermischen Verfahren ist zu verzichten.
Saat- und Pflanzgut auswählen
Basierend auf der Planung wird das Saatgut ausgewählt. Hochwertigen Mischungen haben einen Wildstauden-Anteil von mindestens 20% [8]. Es soll nur Saatgut verwendet werden, das einheimische und standortgerechte Pflanzenarten enthält. Die enthaltenen Arten und ihre Anteile sollen bekannt sein [8]. Grundsätzlich gilt: Je grösser der Anteil Wildstauden in der Saatmischung ist, desto teurer ist das Saatgut [11].
Geeignetes Saatgut aus der Umgebung und Geophyten in Bioqualität sind insbesondere in Bioterra-Wildpflanzengärtnereien erhältlich. Saatgutmischungen für Blumenrasen mit Schweizer Ökotypen bieten auch OH Samen und UFA Samen.
Bei der Ansaat von Blumenrasen ist ausschliesslich Blumenrasensaatgut zu verwenden. Es darf auf keinen Fall anderes Saatgut (z.B. Gebrauchsrasen) dazu gemischt werden, da konkurrenzstarke Kulturgrassorten die Wildstauden und -gräser verdrängen [5].
Hintergründe und Details zur Beschaffung von Saatgut und Pflanzen sind hier zu finden.
Blumenrasen ansäen
Die letzte tiefe Bodenbearbeitung oder das Aufbringen des Substrates muss ungefähr vier Wochen zurückliegen. In der Zeit bis zum optimalen Saatzeitpunkt ist der Boden regelmässig flach zu bearbeiten (ca. 3 cm tief) um das Aufkommen von unerwünschten Pflanzen zu verhindern. Im Spätsommer kann eine nicht überwinternde Gründüngung den Boden bis zum nächsten Frühling vor Erosion und Verunkrautung schützen [13].
Der Blumenrasen wird von April bis Mitte Juni angesät. Eine Ansaat im Frühjahr hat den Vorteil, dass das Risiko einer Bodenverschlämmung gering ist und Schnecken- und Vogelfrass durch das schnellere Auflaufen minimiert werden [5]. Erfolgt die Saat zu früh, kann das Saatgut auf der kalten Bodenoberfläche nicht keimen – im Gegensatz zum ungewollten Beikraut.
In den Sommermonaten ist auf eine Ansaat zu verzichten. In dieser Jahreszeit wäre oftmals eine Bewässerung nötig [7]. Zudem sind für ein gesundes Pflanzenwachstum die Temperaturen zu heiss und die Sonneneinstrahlung zu stark. Herbstsaaten wiederum führen zu gräserreichen Beständen, da viele Staudenarten noch zu schwach sind, um die Wintermonate zu überstehen [13].
Das Saatgut wird in zwei Arbeitsgängen kreuzweise auf feinkrümeligem Boden eingesät. Standardmässig werden ca. 6 g Samenmischung pro Quadratmeter gesät. Falls das Saatgut mit Saathelfer gestreckt ist, sind die Herstellerempfehlungen zu befolgen. Sind keine Saathelfer enthalten, kann für eine gleichmässige Aussaat das Saatgut mit leicht feuchtem Sand gemischt werden [5]. Dadurch kleben die Samen an den Sandkörnern und das Abdriften der Samen durch den Wind kann verhindert werden [5].
Das Saatgut ist leicht anzuklopfen oder einzuwalzen. Auf keinen Fall darf das Saatgut in den Boden eingearbeitet werden, da die meisten Wildstauden Lichtkeimer sind.
Im Vergleich zur Keimzeit von Gebrauchsrasen (8 bis 10 Tage) beginnen Blumenrasensamen wesentlich langsamer zu keimen (1 bis 3 Monate). Da sich die Vegetation langsam entwickelt, kann es einige Jahre dauern, bis sich das gewünschte Vegetationsbild einstellt. Zu Beginn weist der Blumenrasen eine lückenhafte Vegetation auf, die sich langsam mit sich ausbreitenden Pflanzen schliesst – ebenfalls können sich dadurch Pflanzen aus der Umgebung in den Lücken ansiedeln [9].
Die Ansaat kann bei Bedarf auch mit einer Initialpflanzung oder einer Sodenversetzung kombiniert werden. Dabei breiten sich die Pflanzenarten der Initialpflanzung oder Sodenversetzung im Laufe der Zeit auf der restlichen Fläche aus.
Geophyten ausbringen
Sind Blumenzwiebeln vorgesehen, werden diese in einem separaten Arbeitsschritt im Herbst oder Frühling versenkt. Da diese Pflanzen nicht vor der Samenreife gemäht werden sollten, sind sie vorzugsweise in den Randbereichen oder als Inseln zu setzen, die bei den ersten Mähdurchgängen ausgespart werden können [8].
Erstellungs- und Entwicklungspflege durchfüren
Die Entwicklung eines Blumenrasens dauert einiges länger als die eines Gebrauchsrasens. Einen Monat nach der Aussaat ist von den ausgesäten Arten noch nichts zu sehen. Es dominieren spontan wachsende Beikräuter, welche aber wichtig sind, da sie die auflaufende Saat vor Sonnenstrahlen schützen [13]. Im Aussaatjahr laufen hauptsächlich einjährige Wildpflanzen (Therophyten) auf [5].
Unerwünschte Pflanzen sollen nicht gejätet werden [14]. Blumenrasen werden grundsätzlich nicht bewässert; auch nicht nach der Aussaat, weil davon insbesondere Gräserarten profitieren. Aus demselben Grund werden Blumenrasen nicht gedüngt; auch nicht im Aussaatjahr.
Hingegen sind im ersten Jahr mehrere Säuberungsschnitte durchzuführen. Der erste erfolgt, sobald die Vegetation 30 bis 40 cm hoch ist und kein Licht mehr auf den Boden fällt [13]. Säuberungsschnitte werden mit der Sense oder einem hochgestellten Rasenmäher (höchste Stufe) durchgeführt. Weitere Säuberungsschnitte erfolgen, sobald die Vegetationshöhe wieder 10 cm beträgt. Dadurch werden Rosettenpflanzen gestärkt und es kann sich eine Grasnarbe bis Ende der ersten Vegetationsperiode entwickeln [5].
Das Schnittgut ist von der Fläche zu entfernen [14]. Nach dem ersten Schnitt gelangt wieder Sonnenlicht auf den Boden und die Samen der ausgesäten Arten beginnen zu keimen [5].
Eine erste Erfolgskontrolle wird erst nach dem ersten Winter empfohlen.
Im zweiten Jahr nach der Aussaat sind keine Säuberungsschnitte mehr erforderlich. Das Schnitt- wie auch das übrige Pflegeregime entspricht ab dann demjenigen der Erhaltungspflege.
Pflege
-
4 bis 6 Mal pro Jahr mähen, Blumeninseln oder Randstreifen, wo möglich und sinnvoll, stehen lassen
-
Entfernung des Schnittguts
-
1 bis 2 Mal pro Jahr lauben
-
Keine Bewässerung, Düngung und Pestizide
-
Schnitthöhe > 5 cm
-
Problempflanzen punktuell und manuell entfernen
-
Ränder nach Bedarf chappieren
Naturnahe Pflege
Die floristische Zusammensetzung verschiedener Blumenrasen kann sich stark unterscheiden, da sich die Pflanzengesellschaften in Blumenrasen mit der Zeit lokalen Umständen wie Standort, Nutzungsdruck und Pflegeregime anpassen. Dadurch wird der Blumenrasen immer stabiler und widerstandsfähiger. Um diese Pflanzengemeinschaften zu erhalten, dürfen Blumenrasen nicht bewässert, gedüngt oder mit Pflanzenschutzmitteln behandelt werden. Ausserdem müssen alte Pflegeregime möglichst beibehalten werden. Dies ist vor allem bei Pächter- oder Nutzerwechseln zu beachten [1][15].
Die wichtigste Pflegemassnahme eines Blumenrasens ist die regelmässige Mahd. Es darf maximal einmal im Monat gemäht werden. Je nach Nutzungsdruck und gestalterischen Ansprüchen kann das Mahdintervall vergrössert werden. Die Auswahl der Pflegemassnahmen für Blumenrasen erfolgt entsprechend der Definition des individuellen SOLL-Zustandes der Fläche.
Massnahmen naturnahe Pflege im Jahresverlauf
Für die Pflegenden vor Ort gilt es abzuwägen, wie stark das ökologische Potenzial ausgeschöpft werden kann, ohne die gestalterischen Ansprüche an den Blumenrasen zu beeinträchtigen. Ausserdem müssen bei der Wahl der Pflegemassnahmen der IST-Zustand und mögliche Probleme der Fläche berücksichtigt werden. Ein zu hoher Nährstoffgehalt des Bodens oder häufig wechselnde Pflegeregime können die Vielfalt der blühenden Pflanzen verringern und Gräser bevorzugen. In diesen Fällen kann eine kontinuierliche Pflege mit Abführen des Schnittguts den IST-Zustand verbessern.
Planungs- und Umsetzungshilfen
Der Profilkatalog naturnahe Pflege vermittelt Fachwissen und Handlungsanleitungen zu sämtlichen Profilen. Das Praxishandbuch ist eine kompakte Kurzfassung des Kataloges. Im Jahrespflegeplaner sind die Pflegemassnahmen für alle Profile in einer Excel-Tabelle zusammengestellt.
Massnahmen im Detail
Vegetation regulieren
Der erste Schnitt im Jahr erfolgt spätestens Anfang Mai. Danach werden Blumenrasen nach Bedarf und Nutzungsansprüchen alle 4 bis 6 Wochen gemäht [2]. Blumeninseln stehen lassen, damit sich die Pflanzen versamen können.
Bei der Mahd sind nach Möglichkeit und gemäss Nutzungs- und Gestaltungsansprüchen Randbereiche sowie einige Blumeninseln stehen zu lassen, um Insekten und Kleintieren einen Rückzugsort zu bieten und die Versamung der Blüten zuzulassen. Der Ort von Blumeninseln soll über die Jahre variieren [15]. Das Schnittgut ist bei jeder Mahd zusammenzunehmen und abzuführen [1].
Ist der Boden sehr nährstoffreich, kann dies zu einer höheren Wüchsigkeit und einer geringen Vielfalt an Blütenpflanzen führen, weshalb eine (leicht) erhöhte Schnitthäufigkeit angezeigt sein kann, um den Boden abzumagern.
Schwer zugängliche Stellen mähen
Nach dem Mähen müssen nach Bedarf die mit dem Mähgerät schwer zugänglichen Stellen, wie etwa entlang von Wegen, Rabatten oder um Bäume und Sträucher, nachgeschnitten werden. Um Sträucher und Hecken sollte mit grösster Vorsicht gemäht werden, um keine Tiere (z B. Igel) oder die Gehölze selbst zu verletzten [16].
Maschinen auswählen
Sense und Balkenmäher schonen die Tierwelt und sind deshalb Rasenmähern, Sichelmähern oder Motorsensen vorzuziehen. Es ist bei allen Geräten auf mindestens 5 cm Schnitthöhe zu achten, da sich die Wildstauden sonst schlecht erholen können und Gräser gefördert werden.
Auf Mähroboter ist zu verzichten, da sie eine tödliche Gefahr für Kleintiere (insbesondere junge Igel), Amphibien und Insekten darstellen [17].
Problempflanzen entfernen
Nach Bedarf ist der hartnäckige Aufwuchs von unerwünschten Problempflanzen zu entfernen.
Ränder pflegen
Um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten, können die Ränder regelmässig mit einem Spaten abgestochen werden. An Gehölzflächen sollte ein Krautsaum stehen gelassen werden. Diesen abschnittsweise und nur 1 Mal pro Jahr mit Sense oder Balkenmäher schneiden.
Laub entfernen
Im Herbst muss das Laub situativ und je nach Ansprüchen vom Rasen entfernt werden. Dabei sind Synergien mit dem Mähen zu nutzen. Laub ist in Form von Laubhaufen, die über den Winter liegen gelassen werden, ein wertvoller Lebensraum für Kleintiere, insbesondere für Igel.
Instandsetzung
Unebenheiten ausbessern
Da kleinere Unebenheiten interessante Mikrohabitate für zahlreiche Pflanzen darstellen, sollen diese möglichst toleriert werden. Grössere und nutzungseinschränkende Unebenheiten sind je nach Standort mit Oberboden, Sand oder Kies zu füllen und wieder neu anzusäen
Nachsaat von kahlen Stellen
Kleinere kahle Stellen können Mikrohabitate für einige Blumenrasenpflanzen darstellen. Sind die kahlen Stellen unerwünscht, sind sie mit dem Kräuel aufzurauen und neu anzusäen.
Gräseranteil reduzieren
Ein Grund für die Zunahme des Gräseranteils im Laufe der Jahre kann sein, dass durch die Mahd zu wenig Biomasse entfernt wird. Die Schnitthäufigkeit ist in diesen Fällen etwas zu erhöhen. Reduziert sich der Gräseranteil dadurch nicht und sind ansonsten die Standortbedingungen für einen Blumenrasen ideal, ist eine Sanierung zu prüfen.
Moosbewuchs reduzieren
Aus ökologischer und nutzungstechnischer Sicht ist ein Moosbewuchs im Blumenrasen zu reduzieren. Die Gründe für ein (zu) starken Bewuchs können vielfältig sein:
- schwerer, verdichteter Boden, meist in Verbindung mit Staunässe
- Schatten, zum Beispiel unter Bäumen
- zu geringe Schnitthäufigkeit
- Nährstoffmangel
Die genauen Ursachen sind zu eruieren. Hierfür kann eine Standortanalyse nötig sein. Unter Umständen hilft bereits das oberflächliche Aufbringen von Sand. Wird ein Nährstoffmangel festgestellt, kann mit einer Kompostdüngung der Grasbewuchs gefördert werden. Bei schweren und verdichteten Böden mit guten Lichtverhältnissen kann einem unerwünschten Moosbewuchs wohl nur durch eine Sanierung mit Bodenaustausch und Neuansaat der betroffenen Bereiche entgegengewirkt werden. Auf stark beschatteten Flächen ist der Moosbewuchs möglichst zu tolerieren, da sich ein Blumenrasen hier ohnehin nicht optimal entwickeln kann.
Sanierung
Die Sanierung eines Blumenrasens ist dann angezeigt, wenn die grundsätzlichen Standortansprüche erfüllt sind, aber dennoch Gräser- und Moosbewuchs dominieren. Andere Gründe, die eine Sanierung nötig machen sind grossflächig auftretende Problempflanzen, nutzungseinschränkende Unebenheiten und/oder grosse Kahlstellen.
Für eine Sanierung ist die Grasnarbe zusammen mit dem Oberboden zu entfernen. Anschliessend ist geeignetes Substrat einzubauen, bevor die Fläche wieder mit Saatgut begrünt wird
Entwicklung und Förderung
Blumenrasen können sich grundsätzlich infolge gezielter Pflegemassnahmen zu einer Blumenwiese entwickelt. Hierfür darf die Fläche nur noch 2 bis 3 Mal im Jahr gemäht und die Pflegemassnahmen müssen denen einer Blumenwiese angepasst werden. Düngergaben, Bewässerung und das Ausbringen von Herbiziden sind auch bei Blumenwiesen zu unterlassen.
Blumenwiesen können aber nur sehr extensiv genutzt werden. Vor der Umwandlung eines Blumenrasens zur Blumenwiese sind deshalb die Nutzungs- wie auch die Gestaltungsansprüche an die Fläche zu prüfen.
Wird nur die Häufigkeit des Mähens angepasst, entwickelt sich aus einem Blumenrasen meist eine relativ artenarme Blumenwiese. Hinweise zur Planung, Realisierung und Pflege eine artenreiche Blumenwiese sind im Profil Blumenwiese umfassend beschrieben.
Rückbau
-
Wertvolle Pflanzen erhalten
-
Wiederverwendung von Oberboden prüfen
Massnahmen im Detail
Wertvolle Pflanzen erhalten
Müssen wertvolle und artenreiche Blumenrasen zurückgebaut werden, ist die Möglichkeit zu prüfen, die Grasnarbe in Form von Ziegeln auf einen neu anzulegenden Blumenrasen zu transferieren (Sodenversetzung). Wichtig dabei ist, dass die beiden Standorte vergleichbare Standortbedingungen aufweisen.
Alternativ oder zusätzlich können wertvolle Einzelpflanzen ausgegraben und in andere Blumenrasen oder Blumenwiesen eingepflanzt werden.
Oberboden wiederverwenden
Nach Entfernung der Grasnarbe kann der Oberboden für die Realisierung eines neuen Blumenrasens in der Umgebung wiederverwendet werden. Der Oberboden enthält idealerweise wertvolle Blumensamen («Samenbank»), die den neuen Standort aufwerten. Zudem können dadurch möglicherweise Transport- und Materialkosten gespart werden.
Bestimmungen
Gesetzliche und planerische Grundlagen für die Planung, Realisierung, Pflege und Rückbau (kein Anspruch auf Vollständigkeit):
- Chemikalienverordnung (ChemV)
- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV)
- Pflanzenschutzmittelverordnung (PSMV)
Quellen
Ruckstuhl, M., Balmer, H., Wittmer, M., Fürst, M., Studhalter, S., Hose, S., & Fritzsche, M. (2010). Pflegeverfahren. Ein Leitfaden zur Erhaltung und Aufwertung wertvoller Naturflächen. Grün Stadt Zürich, Fachbereich Naturschutz.
Polak, P. (2014). Wiesen und Rasen – Von der Ansaat bis zur Pflege. Land Niederösterreich, Abt. Umwelt- und Energiewirtschaft.
Aufderheide, U. (2011). Rasen und Wiesen im naturnahen Garten: Neuanlage, Pflege, Gestaltungsideen. Pala-Verlag.
biodivers. (2019). Plattform Naturförderung. biodivers. biodivers.ch
Aufderheide, U. (2015). Schöne Wege im Naturgarten—Wege, Plätze und Einfahrten als Lebensräume—Planen, Bauen, Gestalten. pala-Verlag.
Gürke, J. (2014). Blumenwiesen anlegen und pflegen – Pro Natura Praxis (Nr. 21; Pro Natura Praxis). Pro Natura.
Lomer, W., & Voss, H. G. (2009). Der Gärtner 4. Garten- und Landschaftsbau (3. Aufl.). Verlag Eugen Ulmer.
Kumpfmüller, M., & Kals, E. (2009). Wege zur Natur in kommunalen Freiräumen—Handbuch. land-oberoesterreich.gv.at
Kumpfmüller, M., & Hloch, J. (2008). Wege zur Natur im Siedlungsraum—Grundlagenstudie. land-oberoesterreich.gv.at
Hilgenstock, F., Witt, R., Aufderheide, U., Dernbach, D., Koningen, H., Kumpfmüller, M., Lobst, S., Polak, P., & Brenneisen, S. (2017). Das Naturgartenbau-Buch: Nachhaltig denken, planen, bauen: Bd. 1 Band (1. Auflage). Naturgarten Verlag.
Florineth, F. (2012). Pflanzen statt Beton: Sichern und Gestalten mit Pflanzen (2. völlig überarbeitete Auflage). Patzer.
Brack, F., Hagenbuch, R., Wildhaber, T., Henle, C., & Sadlo, F. (2019). Mehr als Grün! – Praxismodule Naturnahe Pflege: Profilkatalog (Grün Stadt Zürich, Hrsg.). ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Forschungsgruppe Freiraummanagement (unveröffentlicht).
Burri, J. (o. J.). Anbauanleitung von Blumenrasen. wildblumenburri.ch
Gähler, M. (2018). Blumenwiesen und Blumenrasen. Naturgarten. naturimgarten.ch
Burri, J. (2011). Blumenrasen—In aller Leute Garten. gplus, 10/2011.
Igelzentrum. (2007). Igelfreundlicher-Garten (Ausgabe 3; S. 21 Seiten). igelzentrum.ch
Tschäppeler, S., & Haslinger, A. (2021). Natur braucht Stadt—Berner Praxishandbuch Biodiversität. Haupt Verlag.