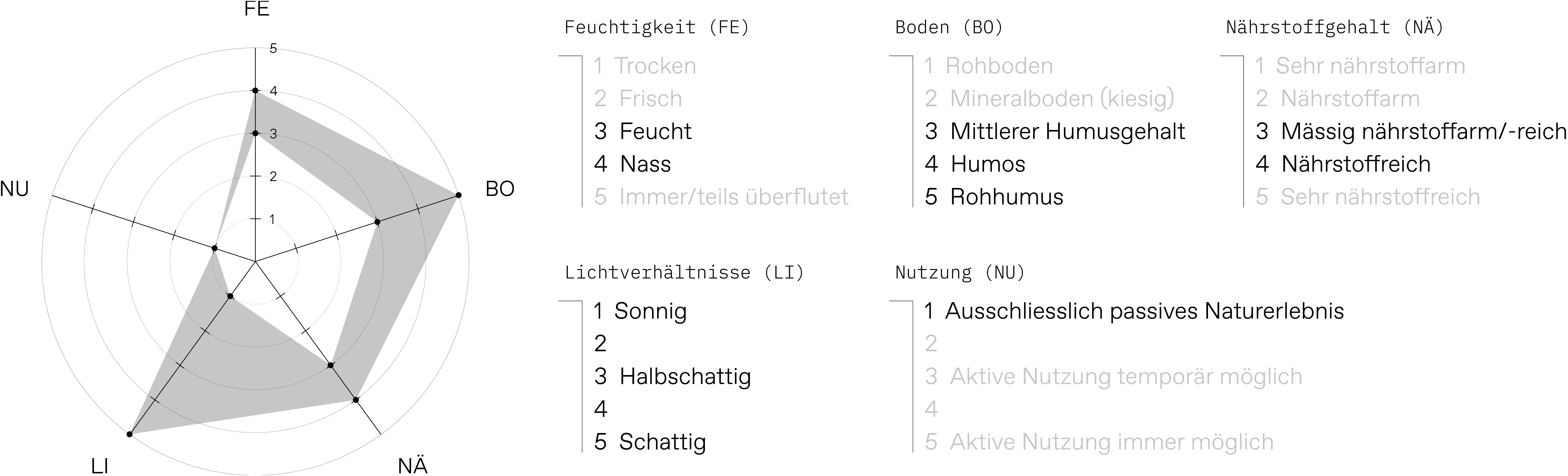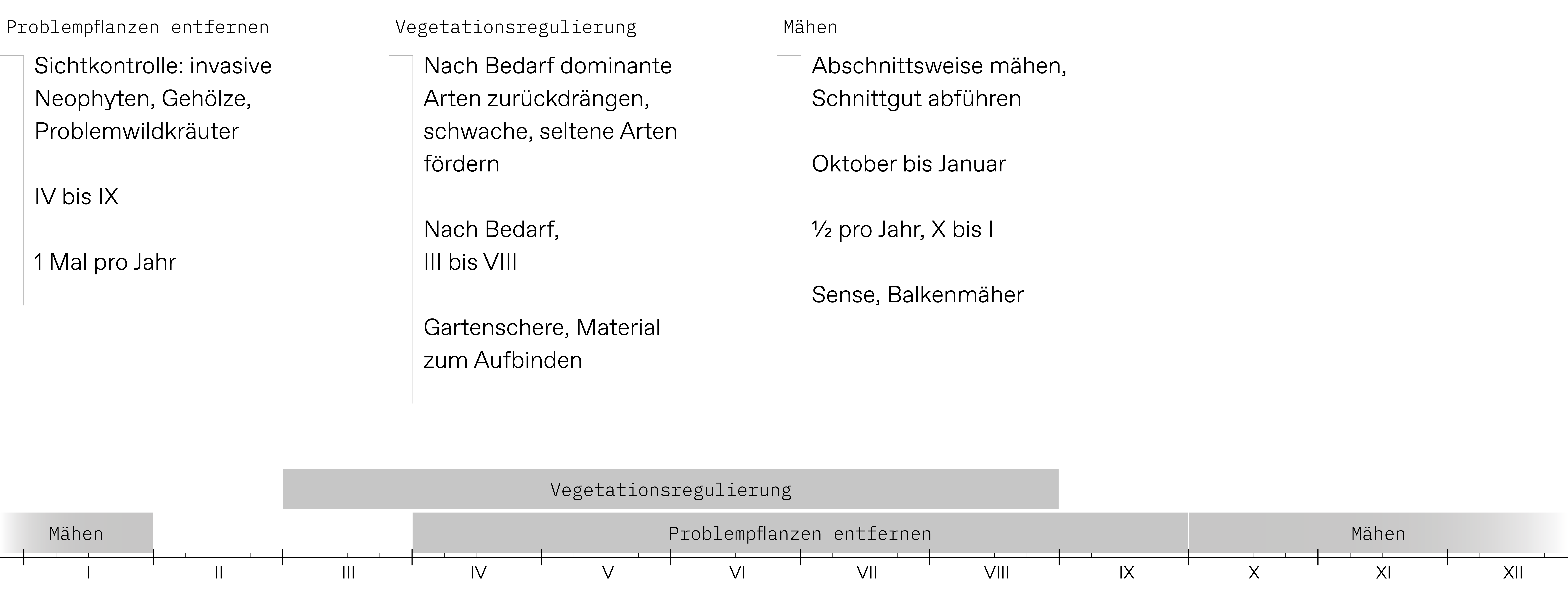In Kürze
Hochstaudenfluren dienen als Versteck- und Fortpflanzungsmöglichkeit, Lebensraum und als Nahrungsquelle für zahlreiche Tierarten.
Kurzdefinition
Hochstaudenfluren bestehen zum Grossteil aus hochwüchsigen, ausdauernden Pflanzen, welche im Winter einziehen und sich jedes Jahr von neuem bilden. Hochstaudenfluren sind besonders struktur- und artenreiche Lebensräume.
Biodiversitätsförderung
Wird das Profil wie auf dieser Seite beschrieben geplant, realisiert und gepflegt, weist es folgende Potenziale auf:
hoch = • • • • • tief = • negativ = (•)
Ökologische Vernetzung
• • •
Lebensraum für Wildtiere
• • • •
Lebensraum für Wildpflanzen
• • • •
Ökologischer Ausgleich
• • • •
Anforderungen
Grundsätze
Mit der Erfüllung dieser Grundsätze wird die Biodiversität gefördert.
Saat- und Pflanzgut
> 80% einheimisch und standortgerecht
Möglichst autochthon
Hohe Artenvielfalt
0% invasive gebietsfremde Arten
Pflege
Möglichst gesamte Fläche gemäss Prinzipien naturnahe Pflege
Alle 2 Jahre abschnittsweise mähen
Nutzung
Keine aktive Nutzung
Standort
Schattig bis halbschattig
Nass bis feucht
Nährstoffreich
Erhöhte Anforderungen
Mit der Erfüllung dieser erhöhten Anforderungen wird die Biodiversität noch stärker gefördert.
Saat- und Pflanzgut
100% einheimisch und standortgerecht
Nur Wild- und keine Zuchtformen
Mindestgrösse
> 5 m2
Aufbau
Kleinstrukturen
Pflege
100% der Fläche gemäss Prinzipien naturnahe Pflege
Faktenblatt
Das Wichtigste ist in diesem Faktenblatt zusammengesellt.
Definition
Hochstaudenfluren bestehen zum Grossteil aus hochwüchsigen, ausdauernden Pflanzen, deren Blätter sich flächig, horizontal und oft über mehrere Ebenen ausbreiten.
Meist handelt es sich dabei um zweikeimblättrige Stauden und Hochgräsern. Ihre Wuchshöhe beträgt 70 bis 160 cm [1]. Unter dem Blätterdach herrscht ein feuchtes, schattiges Mikroklima.
Der Übergang zwischen Hochstaudenfluren und Staudenbepflanzungen ist fliessend. Hochstaudenfluren finden sich meist an feuchteren, nährstoffreicheren Standorten.
Potenzial
Wird das Profil wie auf dieser Seite beschrieben geplant, realisiert und gepflegt, weist es folgende Potenziale auf:
hoch = • • • • • tief = • negativ = (•)
Ökologische Vernetzung
• • •
Lebensraum für Wildtiere
• • • •
Lebensraum für Wildpflanzen
• • • •
Ökologischer Ausgleich
• • • •
Hitzeminderung
• • •
Verbesserung Luftqualität
• • •
Versickerung und Wasserretention
• • • • •
Bodenschutz und Versiegelung
• • • •
aktive Nutzung
• •
passive Nutzung und Aufenthaltsqualität
• • • •
Nutzung, Gestaltung und ökologisches Potenzial
Natürlicherweise besiedeln Hochstaudenfluren vor allem Waldlichtungen, Waldschläge oder regelmässig gestörte Hänge [1]. Hochstaudenfluren sind besonders formen- und artenreiche Lebensräume.
Hochstaudenfluren sind mehrjährige Vegetationsgemeinschaften. Ihre oberirdischen Sprossteile sterben im Winter ab und bilden sich jedes Jahr von neuem. Das feuchte Mikroklima und die jährliche Produktion von grossen Mengen unverholzter Biomasse begünstigen eine rege biologische Aktivität. Auch pflanzenfressende Insekten wie Schmetterlinge oder Pflanzenwespen profitieren von der wüchsigen Vegetation [1].
Im Siedlungsgebiet kommen sie oft an ungestörten, schattigen und feuchten Orten, z.B. an Bächen, Waldrändern, auf brachliegenden Arealen oder in ungenutzten Bereichen entlang von Mauern, Zäunen oder an Grundstücksgrenzen vor. Zunehmend werden sie auch als naturnahes Gestaltungselement oder als Retentions- oder Sickerfläche gezielt angelegt [2].
Es bietet sich an, Hochstaudenfluren an einem tiefen Punkt im Gelände anzulegen, wo sich Regenwasserwasser sammelt. Hochstaudenfluren tragen dazu bei, die Austrocknung des Bodens zu reduzieren [3]. Weiter führen sie und ihre feuchten Standortverhältnisse zu Transpirationskühleffekten.
Hochstaudenflure sind in Siedlungsräumen, aufgrund der Platz- und Nutzungskonkurrenz, eher selten. Auf zu kleinen Flächen können sie sich nicht etablieren.
Hochstaudenfluren sind störungsempfindlich und somit nicht für die direkte Erholungsnutzung geeignet. Der wichtigste Nutzungsaspekt ist die Naturerfahrung.
Aus gestalterischer Sicht vermitteln sie ein üppiges, attraktives, wildes und naturnahes Bild. Das Aussehen von Hochstaudenfluren hängt erheblich von ihrem Standort und ihrer Pflege ab. Der Übergang zur intensiver gepflegten Staudenbepflanzungen kann dabei fliessend sein.
Typische Pflanzen
Hochstaudenflure besiedeln waldfähige Standorte. Dies können Waldlichtungen, Waldschläge oder gestörte Hänge sein. Die typischen Pflanzenarten können von Tieren oder durch Wind weit verbreitet werden und haben eine lange Keimfähigkeit.
Während die feuchte Hochstaudenflur natürlicherweise entlang von Bächen vorkommt oder feuchte Wälder säumt [1], können sie im urbanen Kontext auch in Sickermulden vorkommen. Im Siedlungsgebiet kommen neben den funktionalen Aspekten auch gestalterische dazu. Daher können in der Pflanzenverwendung auch Pflanzenarten von feuchten Krautsäumen integriert werden.
Beispiele Pflanzenarten
Mit diesem Profil können zum Beispiel folgende Pflanzenarten gefördert werden:
Feuchte Hochstaudenflur
Wilde Brustwurz (Angelica sylvestris), Kohldistel (Cirsium oleraceum), Moor-Geissbart (Filipendula ulmaria), Vierflügeliges Johanniskraut (Hypericum tetrapterum), Gemeiner Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris), Blut-Weiderich (Lythrum salicaria), Gewöhnlicher Arznei-Baldrian (Valeriana officinalis)
Kalkreiche Schlagflur
Wasserdost (Eupatorium cannabinum), Wald-Erdbeere (Fragaria vesca), Dunkle Königskerze (Verbascum nigrum), Kleinblütige Königskerze (Verbascum thapsus)
Kalkarme Schlagflur
Wald-Weidenröschen (Epilobium angustifolium), Wald-Vergissmeinnicht (Myosotis sylvatica), Echte Goldrute (Solidago virgaurea)
Unter infoflora.ch sind sämtliche Arten dieses Profils bzw. Lebensraumes zu finden.
Problempflanzen
In diesem Profil sind insbesondere folgende Problempflanzen zu erwarten:
Pflanzen, die an gewissen Standorten oder zu gewissen Zeitpunkten unerwünscht sind
Geissfuss (Aegopodium podagraria), Kriechende Quecke (Elymus repens), Acker-Schachtelhalm (Equisetum arvense)
Echte Zaunwinde (Calystegia sepium), Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense), Brombeere (Rubus fruticosus aggr.)
Invasive gebietsfremde Arten
Einjähriges Berufskraut (Erigeron annuus), Schmalblättriges Greiskraut (Senecio inaequidens), Kanadische Goldrute (Solidago canadensis), Spätblühende Goldrute (Solidago gigantea)
Typische Tiere
Kleintiere wie Spitzmäuse oder Igel profitieren vom reichhaltigen Nahrungsangebot von Hochstaudenfluren. Für sie ist es ein wichtiger Teil des Lebensraumes.
Die grossen Mengen organischen Materials, welche bei Hochstaudenfluren anfallen, fördert zersetzende Mikroorganismen sowie Ringelwürmer, Schnecken und Asseln. Auch Insekten, die sich von lebendem pflanzlichem Material ernähren (z.B. Blattkäfer) kommen in Hochstaudenfluren häufig vor [1].
Auch als Überwinterungsort sind Hochstaudenfluren von bedeutendem Wert. So legen Insekten ihre Eier in hohle Pflanzenstängel, wo diese bis zum Schlüpfen geschützt den Winter überstehen.
Beispiele Tierarten
Typische Tiere, die mit diesem Profil gefördert werden können:
Vögel
Bachstelze (Motacilla alba), Blaumeise (Cyanistes caeruleus), Buntspecht (Dendrocopos major), Rotkehlchen (Erithacus rubecula), Buchfink (Fringilla coelebs), Kohlmeise (Parus major), Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros), Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla), Zaunkönig (Troglodytes troglodytes), Amsel (Turdus merula)
Säugetiere
Hausspitzmaus (Crocidura russula), Igel (Erinaceus europaeus), Weissrandfledermaus (Pipistrellus kuhlii), Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), Hermelin (Mustela erminea), Rötelmaus (Myodes glareolus)
Reptilien
Blindschleiche (Anguis fragilis)
Schmetterlinge
Tagpfauenauge (Aglais io), Kleiner Fuchs (Aglais urticae),
Zitronenfalter (Gonepteryx rhamni), C-Falter (Polygonia c-album),
Admiral (Vanessa atalanta), Distelfalter (Vanessa cardui)
Käfer
Goldglänzender Rosenkäfer (Cetonia aurata), Siebenpunkt-Marienkäfer (Coccinella septempunctata), Echter Widderbock (Clytus arietis)
Standort
Hochstaudenfluren bevorzugen nährstoffreiche, gut bewässerte Böden [2] und ein frischfeuchtes Mikroklima. Verschiedene hochwachsende Stauden sind schattentolerant.
Hochstaudenfluren besiedeln waldfähige Standorte [1]. Der ideale Standort im Siedlungsgebiet ist im Schatten in Bereichen von Gebäuden (halbschattig bis schattig).
Zielbild
Der Boden von Hochstaudenfluren ist nährstoffreich, enthält organisches Material, ist gut mit Wasser versorgt und kann kurzzeitig trocken fallen. Die Pflanzen sind meist zweikeimblättrig. Eine dichte Blätterschicht verhindert, dass Licht auf den Boden fällt.
Auch ohne menschliche Einflüsse bleibt die Vegetationszusammensetzung über einen längeren Zeitraum gleich [1]. Es kann sich eine hochwüchsig (Wuchshöhe 1 bis 2 m), dichte und blütenreiche Vegetation entwickeln.
Einige typische Pflanzenarten wie der Moor-Geissbart (Filipendula ulmaria), der Gelber Fingerhut (Digitalis lutea) und die Wald-Witwenblume (Knautia dipsacifolia) haben einen späten Blütezeitpunkt im Jahr. Die Pflanzen der verschiedenen Ausprägungen von Hochstaudenfluren können von April bis Oktober blühen.
Beispiele
Sammlung von Beispielen, die im Siedlungsgebiet von Schweizer Gemeinden und Städten angelegt wurden.
Planung
-
Boden- und Standortanalyse für Standortwahl durchführen, natürliche Vernässung integrieren
-
Vorhandene Materialien für Bodenaufbau verwenden
-
Kleinstrukturen vorsehen
-
Ausreichende Wasserversorgung der Böden sicherstellen
-
Einheimisches, regionaltypisches, standortgerechtes Saat- und Pflanzgut verwenden und hohe Pflanzenvielfalt anstreben
-
Zukünftige Pflege in Planung miteinbeziehen
Massnahmen im Detail
Nutzung, Funktion und Dimensionierung klären
Es ist zu beurteilen, ob das Ziel der Anlage einer Hochstaudenflur mit den vorgesehenen Nutzungen und Funktionen übereinstimmen.
Die Anlage künstlicher Feuchtlebensräume (feuchte Hochstaudenflur) ist geeignet, wo ehemalige Feuchtflächen wieder vernässt werden können.
Zusätzlich ist abzuklären, ob sich die Feuchtflächen sinnvoll in die umgebenden Biotopsysteme eingliedern lassen. Als Standort bietet sich die Umgebung von Gewässern an sowie Bereiche auf undurchlässigen Böden. Offene Versickerungseinrichtungen bieten eine interessante Perspektive, um feuchte Lebensräume zu initiieren [2].
Ökologie
Ökologischer Ausgleich und Vernetzung
Lebensraum für Tiere und Pflanzen
Hitzeminderung
Versickerung und Wasserretention
Bodenschutz und Versiegelung
Gestaltung
Wildes Erscheiungsbild
Als Retentions- oder Sickerfläche
Im Randbereich von Gewässern
Nutzung
Extensive Nutzungsmöglichkeiten
Passive Naturerlebnisse
Standort wählen
Damit mit dem gesamten Pflanzenspektrum der feuchten Hochstaudenflur gearbeitet werden kann, muss ein vernässter Bodenkörper vorhanden sein. Gründe für die Vernässung können ein hoher Grundwasserspiegel, undurchlässige Bodenschichten oder häufige Überflutungen sein [2]. Undurchlässige Bodenschichten, welche ein feuchtes Milieu schaffen, können geologisch gegeben sein oder durch Bautätigkeit verursacht worden sein.
Neben dem lokalen Wasserhaushalt sind die Lichtverhältnisse ein entscheidender Faktor. Im trockenen und heissen Siedlungsgebiet sind halbschattige bis schattige Bedingungen vorzuziehen, da an diesem Standort die optimalen Feuchtigkeitsverhältnisse eher vorkommen. Bei ausreichender Wasserversorgung entwickeln sich auch an sonnigen Standorten ökologisch wertvolle feuchte Hochstaudenflure.
Mit der Bestimmung der vorhandenen Vegetation können Rückschlüsse auf den Standort gezogen werden. Wenn jedoch Erdarbeiten durchgeführt werden, kann der natürliche Bodenaufbau, der zur Vernässung des Standortes beigetragen hat, verändert respektiv zerstört werden. Folglich ist der Standort ungeeignet für eine feuchte Hochstaudenflur und es ist alternativ eine kalkarme oder kalkreiche Schlagflur zu planen: Kalkarme oder kalkreiche Schlagfluren kommen natürlicherweise in Waldlichtungen, Waldschläge oder gestörte Hängen vor [1].
Weiter sind die Hochstaudenfluren auf eine periodische Mahd angewiesen und insbesondere Schlagflurflächen müssen von Gehölzen freigehalten werden, um die Sukzession in Richtung Wald zu unterbinden [1].
Bestehende Staudenbepflanzugen umwandeln
Durch Ergänzungspflanzungen sowie die tolerierte Einwanderung von Wildpflanzen kann eine nährstoffreiche Staudenbepflanzung in eine Hochstaudenflur umgewandelt werden.
Hochstaudenfluren und Gewässer kombinieren
Hochstaudenfluren können als Übergänge zwischen Blumenwiesen und Gewässern eingesetzt werden. Das üppige, wilde Erscheinungsbild kann daran Menschen hindern, den Bereich des Fliessgewässers zu begehen und so zur Besucherlenkung beitragen.
Bodenvorbereitung planen
Grundsätzlich ist bei der Planung einer Hochstaudenflur eine Schicht von etwa 30 cm Oberboden aufzutragen [4]. Der Oberboden sollte frei von Problempflanzen und unverdichtet sein.
Viele Pflanzenarten der Hochstaudenflur gedeihen an Standorten mit feuchteren Verhältnissen, weshalb auch lehmiges Oberbodenmaterial verwendet werden kann [4]. Auch das Einbringen von gering durchlässigem Schluff, Lehm oder Ton aus dem Untergrund kann zum Abdichten verwendet werden. Die regelmässige Zufuhr von Regenwasser reicht für die Anlage einer feuchten Hochstaudenflur aus [5].
Ist im Untergrund lehmiges Material vorhanden, bietet sich eine Bodenumkehr an. Dabei wird der Oberboden mit dem Unterboden vertauscht. Ein weiterer Vorteil davon ist, dass der Aushub nicht mit Problempflanzen und Wurzelunkräutern belastet ist. Es ist auch möglich, eine Lehmschicht unterhalb des Oberbodens einzuplanen, um gezielt feuchte Verhältnisse zu schaffen.
Falls kein geeigneter Oberboden am Standort vorhanden ist, kann nach Möglichkeit in einem anderen Bereich des Bauprojekts (z.B. bei der Erstellung einer Ruderalvegetation) Oberboden gesichert werden. Wichtig ist, dass der Oberboden richtig zwischengelagert wird. Alternativ kann ein adäquater Oberboden lokal beschafft und eingebaut werden.
Begrünung planen
Eine Hochstaudenflur kann mittels Ansaat von Wildstaudensamenmischungen oder einer Bepflanzung mit einheimischen Wildstauden angelegt werden. Auch eine Kombination aus Ansaat und Initialbepflanzung ist möglich [5]. Eine Initialbepflanzung ist aus Kostengründen nur bei kleineren Flächen oder Teilflächen sinnvoll.
Als Ansaat- oder Bepflanzungstermin sollte der Frühling oder Herbst gewählt werden.
Bei der Pflanzenwahl können sich Planende an den natürlicherweise vorkommenden Hochstaudenfluren der Schweiz (vgl. Delarze, Gonsetz, Eggenberg & Vust. 2015. Lebensräume der Schweiz) sowie Info Flora, das nationale Daten- und Infozentrum der Schweizer Flora, mit seinen artspezifischen Steckbriefen, orientieren.
Die Pflanzenarten der Hochstaudenfluren haben einen hohem Nährstoff- und Wasserbedarf (sogenannte C-Strategen). Die Verfügbarkeit von einheimischen Wildstauden bei lokalen Produzenten ist frühzeitig zu prüfen.
Kleinstrukturen planen
Die ökologische Qualität von Hochstaudenfluren kann mit Kleinstrukturen erhöht werden. Schnittgut-Haufen können als potenzieller Eiablageplatz für Blindschleichen und andere Reptilien wertvoll sein.
Die Dimensionierung, Materialisierung und Anordnung der Strukturen ist neben ökologischen Kriterien auch auf Gestaltungs- und Nutzungsansprüche abzustimmen. Insbesondere ist die künftige Pflege der Fläche mit zu berücksichtigen, indem beispielsweise durch eine Bündelung der Kleinstrukturen eine effiziente Mahd der Fläche weiterhin gewährleistet bleibt.
Pflege planen
Bereits in der Planung sollte die fachgerechte Pflege einer Hochstaudenflur schriftlich festgehalten werden. Befindet sich die Hochstaudenflur in einem gut einsehbaren Bereich, empfiehlt sich dominante Arten zurückzuschneiden und schwachswüchsige Arten zu fördern. Im Sinne der Biodiversitätsförderung ist eine möglichst hohe Pflanzenvielfalt erstrebenswert.
Da es sich bei der Hochstaudenflur um ein Rückzugsbiotop handelt, ist die fachgerechte Mahd entscheidend und sollte frühzeitig den zukünftig Pflegenden kommuniziert werden.
Handelt es sich um eine grossflächige Hochstaudenflur und lässt es das Nutzungs- und Gestaltungskonzept zu, kann das Schnittgut vor Ort zu einem Haufen angelegt werden und als potenzieller Eiablageplatz für Blindschleichen und andere Reptilien fungieren [6]. Dies ist im Pflegeplan zu vermerken und zu kommunizieren.
Ausführung planen
In der Planung ist zu bestimmen, wie Arbeiten ausgeführt werden sollen, woher die Materialien bezogen werden können und wie sie transportiert werden sollen: Von Hand (z. B. Spaten, Schubkarre) oder mit Maschineneinsatz (z.B. Rasenschäler, Dumper). Auch die Zufahrten für Maschineneinsatz und Transport sind zu klären und zu berücksichtigen.
Die Ausführung und Erstellung können basierend auf der Planung ausgeschrieben und an ein Unternehmen vergeben werden. Die Leistungsausschreibung ist neben Massangaben auch mit Qualitätsvorgaben zu versehen. Die in dieser Web App vorhandenen Grundlagen (z.B. Referenzbilder, qualitative und quantitative Anforderungen) können hierfür genutzt werden.
Kosten schätzen
Erstellungskosten
Die Erstellungskosten sind abhängig von Grösse und Topografie der Fläche und den Personal- und Materialkosten, Pauschalen für Anfahrt und Baustellenvorbereitung und -installation sowie Kosten für Maschinen, Materialabtransport und Deponiekosten. Für eine Kostenschätzung sind Offerten bei verschiedenen Unternehmen einzuholen.
Dabei ist klar zu definieren, inwiefern die Erstellungs- und Entwicklungspflege der ersten Jahre ebenfalls in der Offerte enthalten sein soll. Kompetenzen in der Erstellung von Blumenrasen haben zum Beispiel Bioterra-Fachbetriebe.
Betriebs- und Unterhaltskosten
Hochstaudenfluren sind eher pflegeleicht, die Betriebs- und Unterhaltskosten entsprechend gering.
Die langfristigen Unterhaltskosten können basierend auf der Planung zum Beispiel mit den Kennzahlen der VSSG ermittelt werden.
Weitere Informationen zu den Kosten und Nutzen.
Realisierung
-
Boden vor Ansaat nicht mehr als 3 cm tief bearbeiten
-
Feinkürmeliges Saatbeet vorbereiten
-
Saat- und Pflanzgut über regionale Betriebe beziehen
-
Keine Bewässerung und Düngung nach Aussaat
-
Nach Bodenvorbereitung Boden > 4 Wochen absetzten lassen und vor Ansaat aufkommende Pflanzen entfernen
-
Hochstaudenflur Saat- und Pflanzgut aus einheimischen und standortgerechten Pflanzenarten verwenden
-
Fachgerechte Ansaat im Herbst
-
Säuberungsschnitte im Aussatjahr
Massnahmen im Detail
Boden vorbereiten
Verdichteten Bodenhorizonte im Untergrund (z.B. durch Bauarbeiten) können belassen werden, da sehr feuchte Verhältnisse von gewissen Pflanzenarten (z.B. Angelica sylvestris, Lythrum salicaria, Mentha longifolia) bevorzugt werden.
Soll der Boden für feuchtigkeitsliebende Pflanzenarten vorbereit werden, kann lehmiger Oberboden eingebaut werden. Alternativ kann eine 5 bis 10 cm dicke Lehmschicht unterhalb des Oberbodens (25 bis 30 cm dicke Schicht) eingebaut und leicht verdichtet werden.
Kommt der Oberboden von einer anderen Stelle im Bauprojekt, ist für eine korrekte Zwischenlagerung zu sorgen. Ansonsten ist ein adäquater Oberboden lokal zu beschaffen und einzubauen.
Um Senkungen der Bodenschicht zu verhindern, darf der Boden mindesten einen Monat vor der Ansaat nicht mehr tief bearbeitet werden [5]. Auch das Aufbringen des Substrates sollte mindestens 4 bis 6 Wochen zurückliegen.
Vor der Ansaat wird der aufgelaufene Bewuchs mechanisch entfernt. Dabei erfolgt die Bearbeitung nur oberflächlich (2 bis 3 cm tief) [5]. Wird die Rohplanie im Sommer oder Winter erstellt, keimen bis zur Ansaat im Herbst oder Frühling unerwünschte Pflanzen. Diese Pflanzen sind vor der Ansaat manuell oder mechanisch zu entfernen.
Saat- und Pflanzgut auswählen
Basierend auf der Planung wird das Saatgut ausgewählt.
Hochwertigen Mischungen haben einen hohen Wildstauden-Anteil. Es soll nur Saatgut verwendet werden, welches einheimische und standortgerechte Pflanzenarten enthält. Die enthaltenen Arten, ihre Herkunft sowie ihre Anteile sollen bekannt sein.
Geeignetes Saatgut aus der Umgebung in Bioqualität sind insbesondere in Bioterra-Wildpflanzengärtnereien erhältlich.
Ansaat
Die Ansaat der Hochstaudenflur von April bis Ende Mai hat den Vorteil, dass das Risiko einer Bodenverschlämmung gering ist und Schnecken- und Vogelfrass durch das schnellere Auflaufen des Saatgutes minimiert wird. Dennoch sind Herbstsaaten von Oktober bis Dezember zu bevorzugen. Pflanzenarten der Hochstaudenflur keimen eher ungleichmässig und über eine lange Keimperiode verteilt.
Einige Pflanzenarten der feuchten Hochstaudenflur sind Kaltkeimer (z.B. Wilde Brustwurz (Angelica sylvestris), Moor-Geissbart (Filipendula ulmaria), Gelbe Wiesenraute (Thalictrum flavum), Gewöhnlicher Arznei-Baldrian (Valeriana officinalis)) [7]. Sie benötigen zum Keimen mehrere Kalt-Warm-Phasen. Besonders Einwirkungen von niederen Temperaturen unter 5 °C sind von Vorteil.
Das Saatgut wird kreuzweise eingesät. Bei der Saatgutmenge pro Quadratmeter gilt es die Herstellerangaben zu beachten. Ist kein Saathelfer in der Mischung enthalten, kann für eine gleichmässige Aussaat das Saatgut mit leicht feuchtem Sand gemischt werden. Dadurch kleben die Samen an den Sandkörnern und das Abdriften der Samen durch den Wind kann verhindert werden.
Das Saatgut ist leicht anzuklopfen oder einzuwalzen. Auf keinen Fall darf das Saatgut angegossen werden [7].
Pflanztechnik
Die Topfballen der Stauden sollten vor der Pflanzung in Wasser getaucht werden, damit diese tropfnass sind. Bei stark durchwurzelten Topfballen kann das Wurzelgeflecht durch seitliches Aufreissen geöffnet werden.
Die Stauden werden 1 bis 2 cm tiefer als die Umgebung gepflanzt [8].
Kleinstrukturen erstellen
Die Kleinstrukturen sind an den in der Planung vorgesehenen Standorten und in den festgelegten Qualitäten zu erstellen. Macht die Planung keine spezifischen Angaben zu Standorten und Qualitäten, können diese auch ad hoc vor Ort unter Berücksichtigung der Planungs- und Realisierungshinweise zu einzelnen Kleinstrukturen erstellt werden.
Das im Rahmen von Schnitt- und Pflegemassnahmen anfallende Material (z.B. Äste, Totholz, Blüten- und Samenstände) eignen sich hierfür bestens. Dadurch können Eiablageplätze für Ringelnattern und andere Schlangen geschaffen werden [6].
Erstellungs- und Entwicklungspflege durchfüren
Gepflanzte Stauden sollen nur im Pflanzjahr bei einer lang andauernden Trockenperioden gewässert werden.
Hochstaudenfluren werden grundsätzlich nicht bewässert und gedüngt; auch nicht nach der Aussaat. Die Keimphase des Saatgutes dauert mindestens ein ganzes Jahr. Sobald die Vegetation (Spontanverunkrautung) ca. 20 cm hoch ist oder zu blühen beginnt, sollte der erste Säuberungsschnitte mit der Sense, dem Balkenmäher oder einem hochgestellten Rasenmäher (höchste Stufe) durchgeführt werden [7]. Das Schnittgut ist zusammenzunehmen und von der Fläche zu entfernen.
Mit dem Schnittgut kann an sonnig bis halbschattig und wind- und hochwassergeschützten Standorten in deckungsreicher Umgebung ein Haufen angelegt werden. Feines Material ist mit Ästen oder Zweigen aufzulockern, damit der Zugang für Reptilien und die Durchlüftung gewährleistet ist. Die Haufen jährlich mit neuem Material ergänzen oder alle zwei Jahre ersetzen.
Weitere Säuberungsschnitte erfolgen im weiteren Jahresverlauf, wenn die Vegetation jeweils wieder ca. 20 cm hoch ist.
Im zweiten Jahr nach der Aussaat sind keine Säuberungsschnitte mehr erforderlich. Das Schnitt- wie auch das übrige Pflegeregime entspricht ab dann demjenigen der Erhaltungspflege.
Pflege
-
Sichtkontrollen durchführen, invasive gebietsfremde Pflanzen und Gehölze entfernen
-
Unterhalten und Ergänzen von Kleinstrukturen
-
Alle zwei Jahre abschnittsweise, zwischen November und Januar, mit einem Balkenmäher mähen
-
Kein Pestizideinsatz
Naturnahe Pflege
Hochstaudenfluren sind sehr naturnahe Vegetationsgemeinschaften. Um ihren natürlichen Zustand zu erhalten, ist nur eine extensive Pflege nötig.
Die wichtigste Massnahme ist das Entfernen von invasiven gebietsfremden Pflanzen, Gehölzen und anderen problematischen Pflanzen.
Aufgrund der schattigen Bedingungen am Boden können sich Gehölze in Hochstaudenfluren oft nicht durchsetzen. Je nach Anforderungen bezüglich Gestaltung und Pflege können einige Arten der Hochstaudenflur gezielt gefördert, nachgepflanzt oder unterdrückt werden, wodurch sich der Pflegeaufwand erhöht.
Um das ökologische Potential auszuschöpfen, werden nur die unbedingt nötigen Pflegemassnahmen ergriffen. Hierfür werden Hochstaudenfluren gestaffelt nur jedes zweite Jahr gemäht, um die Fauna möglichst zu schonen. Das Schnittgut wird abgeführt
Massnahmen naturnahe Pflege im Jahresverlauf
Hochstaudenfluren dürfen nicht gedüngt oder gewässert werden. Es dürfen ebenfalls keine Pestizide ausgebracht werden.
Die Auswahl der Pflegemassnahmen für Hochstaudenfluren erfolgt entsprechend der Definition des individuellen SOLL-Zustandes der Bepflanzung. Für die Pflegenden vor Ort gilt es abzuwägen, ob und welche Pflegemassnahmen nötig sind, um die gestalterischen Ansprüche zu erfüllen. Ausserdem müssen bei der Wahl der Pflegemassnahmen der IST-Zustand und mögliche Probleme der Hochstaudenflur, wie z.B. das Vorkommen invasiver gebietsfremder Arten, berücksichtigt werden.
Planungs- und Umsetzungshilfen
Der Profilkatalog naturnahe Pflege vermittelt Fachwissen und Handlungsanleitungen zu sämtlichen Profilen. Das Praxishandbuch ist eine kompakte Kurzfassung des Kataloges. Im Jahrespflegeplaner sind die Pflegemassnahmen für alle Profile in einer Excel-Tabelle zusammengestellt.
Massnahmen im Detail
Unerwünschte Arten entfernen
Bei einer Sichtkontrolle wird das Vorkommen von invasiven gebietsfremden Arten, Gehölzen und Problempflanzen in der Hochstaudenflur geprüft.
Hochstaudenfluren sind Habitate einiger invasiver gebietsfremder Arten, wie z.B. Riesenbärenklau (Heracleum mantegazzianum) oder drüsiges Springkraut (Impatiens glandulifera). Es ist besonders wichtig, sie vor ihrer Samenreife zu entfernen. Die entfernten Pflanzen dürfen nicht auf der Fläche zurückgelassen oder mit dem normalen Schnittgut gelagert werden.
Vegetation regulieren
Die Vegetationsregulierung hängt massgeblich vom Standort und den gestalterischen Ansprüchen an die Hochstaudenflur ab. Je nachdem müssen zu dominante Arten zurückgeschnitten, schwache Arten gefördert oder nachgepflanzt, sowie Problempflanzen entfernt werden.
Die Vegetation der Hochstaudenfluren muss nicht zwingend reguliert, sondern kann auch ihrer natürlichen Entwicklung überlassen werden.
Mähen
Hochstaudenfluren werden alle zwei Jahre gemäht. Die Mahd erfolgt während der Vegetationsruhe und vor dem Austrieb der Frühblüher, also zwischen Oktober und Januar. Das Schnittgut wird abgeführt.
Es muss abschnittsweise gemäht werden, um Rückzugsbiotope zu erhalten. Der nicht gemähte Abschnitt wird im Folgejahr gemäht.
Instandsetzung
Sehr wüchsige Bereiche oder Abschnitte, in denen nur eine oder zwei Pflanzenarten dominieren, können abmagert werden. Dazu ist Sand einzubringen [5].
Bei sehr grossen Flächen ist zu prüfen, ob die gesamte Fläche abschnittsweise über mehrere Jahre instand gesetzt werden soll [9]. Durch eine Staffelung findet die vorhandene Fauna Rückzugsmöglichkeiten während der baulichen Tätigkeit.
Sanierung
Die Sanierung einer Hochstaudenflur ist dann angezeigt, wenn invasive gebietsfremde Arten oder Gehölze die gesamte Fläche bewachsen und die Mahd oder das mechanische Entfernen nicht mehr ausreichen. Je nach Pflanzenart ist der Boden-Austausch in Teilbereichen zu prüfen.
Entwicklung und Förderung
Um das ökologische Potential von Hochstaudenfluren weiter zu fördern, sollten in der Nähe weitere naturnahe Kleinstrukturen angelegt werden. Dies können vor allem Wurzelstöcke sowie Ast- und Steinhaufen sein. Während verschiedene Kleinlebewesen in Hochstaudenfluren Nahrung finden, bieten ihnen diese Kleinstrukturen Schutz.
Rückbau
-
Wertvolle Pflanzen erhalten
-
Wiederverwendung von Oberboden prüfen
-
Sodenversetzung prüfen
-
Wiederverwendung von Kleinstrukturen prüfen
Massnahmen im Detail
Wertvolle Pflanzen erhalten
Müssen wertvolle und artenreiche Hochstaudenfluren zurückgebaut werden, ist zu prüfen, ob die Vegetationsdecke in Form von Soden auf einen neu anzulegenden Hochstaudenflur transferiert werden kann [10]. Voraussetzung ist, dass die beiden Standorte vergleichbare Standortbedingungen aufweisen.
Alternativ oder zusätzlich können wertvolle Einzelpflanzen ausgegraben und in andere Hochstaudenfluren eingepflanzt werden. Weiter könnte das Saatgut der verschiedenen Pflanzenarten im Jahresverlauf gesammelt werden und auf der neuen Fläche ausgebracht werden.
Oberboden wiederverwenden
Nach Entfernung der Vegetationsdecke kann der Oberboden für die Realisierung einer neuen Hochstaudenflur in der Umgebung wiederverwendet werden. Der Oberboden enthält idealerweise wertvolle Pflanzensamen, die den neuen Standort aufwerten. Zudem können dadurch möglicherweise Transport- und Materialkosten gespart werden.
Kleinstrukturen wiederverwenden
Sind in einer Hochstaudenflur Kleinstrukturen vorhanden, ist zu prüfen, ob diese und/oder Teile davon in einer anderen Hochstaudenflur oder innerhalb eines anderen Profils wiederverwendet werden können.
Bestimmungen
Gesetzliche und planerische Grundlagen für die Planung, Realisierung, Pflege und Rückbau (kein Anspruch auf Vollständigkeit):
- Chemikalienverordnung (ChemV)
- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV)
- Pflanzenschutzmittelverordnung (PSMV)
- Bundesgesetz über den Schutz der Gwässer (GSchG)
Quellen
Delarez, R., Gonseth, Y., Eggenberg, S., & Vust, M. (2015). Lebensräume der Schweiz. Ökologie-Gefährdung- Kennarten. (3., vollständig überarbeitete Auflage). hep verlag ag.
Kumpfmüller, M., & Hloch, J. (2008). Wege zur Natur im Siedlungsraum—Grundlagenstudie. https://land-oberoesterreich.gv.at/
Bundesamt für Umwelt BAFU. (2018). Hitze in Städten: Grundlage für eine klimaangepasste Siedlungsentwicklung (Umwelt-Wissen, Klima, S. 108 Seiten). BAFU.
Richard, P. (2018). Der gestaltete Naturgarten. Wildromantische Gärten planen und bauen. Haupt Verlag.
Hilgenstock, F., Witt, R., Aufderheide, U., Dernbach, D., Koningen, H., Kumpfmüller, M., Lobst, S., Polak, P., & Brenneisen, S. (2017). Das Naturgartenbau-Buch: Nachhaltig denken, planen, bauen: Bd. 1 Band (1. Auflage). Naturgarten Verlag.
Meyer, A., Dušej, G., Bütler, M., Monney, J.-C., Billing, H., Mermod, M., Jucker, K., & Bovey, M. (2011). Praxismerkblatt Kleinstrukturen Eiablageplätze für Ringelnattern und andere Schlangen. karch Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz.
Die Wildstaudengärtnerei AG. (o. J.). Hochstaudenflur.
Bouillon, J. (Hrsg.). (2013). Handbuch der Staudenverwendung: Aus dem Arbeitskreis Pflanzenverwendung im Bund deutscher Staudengärtner Empfehlungen für Planung, Anlage und Management von Staudenpflanzungen. Eugen Ulmer KG.
Kumpfmüller, M., & Kals, E. (2009). Wege zur Natur in kommunalen Freiräumen—Handbuch. https://land-oberoesterreich.gv.at/
BAFU. (2010). Ingenieurbiologische Bauweisen im naturnahen Wasserbau (Umwelt-Wissen, S. 59 Seiten) [Leitfaden]. Bundesamt für Umwelt (BAFU). https://bafu.admin.ch/