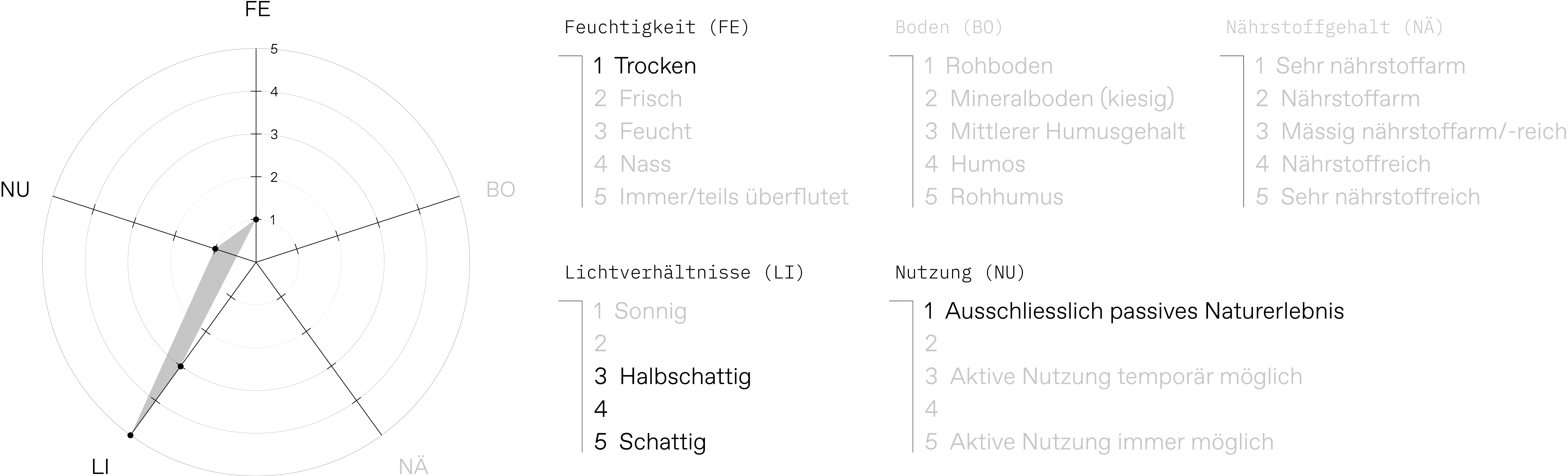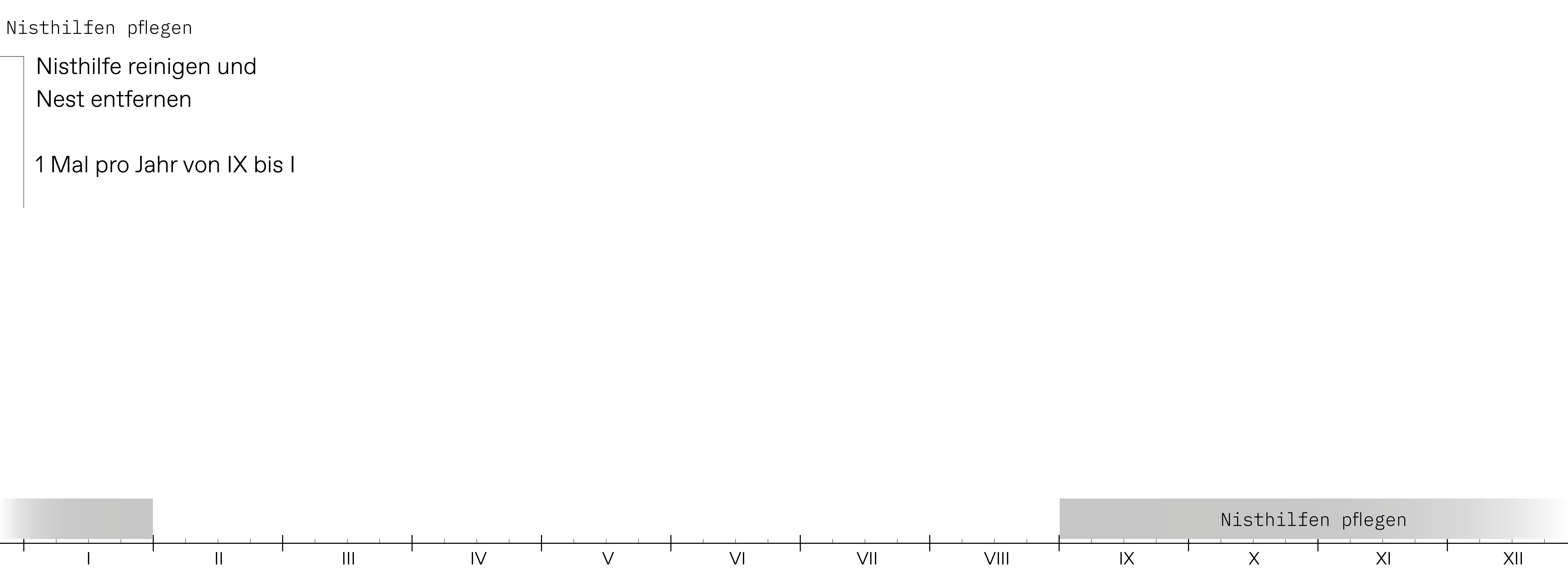In Kürze
Nisthilfen ersetzen die zunehmend verschwindenden Nistmöglichkeiten an sanierten oder neu erstellen Gebäuden und bieten wichtige Nist- und Brutplätze für Vögel, Wildbienen und Säugetiere.
Anforderungen
Grundsätze
Mit der Erfüllung dieser Grundsätze wird die Biodiversität gefördert
Aufbau
Anbringung in artspezifischer Höhe
Pflege
1 Mal jährlich Reinigung zwischen Oktober und Februar
Alle 2 Jahre Reinigung von Schwalben-Kunstnestern
Alle 3 bis 5 Jahre Reinigung von Segler- und Dohlenkästen
Nutzung
Keine aktive Nutzung
Standort
Schattig bis halbschattig
Einfluglöcher gegen Osten- oder Südosten
Witterungsgeschützt
Erhöhte Anforderungen
Mit der Erfüllung dieser erhöhten Anforderungen wird die Biodiversität noch stärker gefördert.
Aufbau
Nisthilfen an Leitarten angepasst
Nisthilfen für unterschiedliche Arten
Mindestgrösse
An jedem zweiten Baum eine Nisthilfe
Vermeidung von Revier-Konkurrenz
Kurzvideo
Definition
Bei Nisthilfen handelt es sich um künstlich hergestellte Bauten für die Fortpflanzung bestimmter Tiergruppen.
Im Siedlungsgebiet sind natürliche Nist- und Brutplätze selten, weil natürliche Strukturen wie alte Bäume mit Asthöhlen oder Spalten zunehmend verschwinden und Hohlräume in sanierten oder neu erstellten Gebäuden oftmals fehlen.
Nisthilfen in Freiräumen oder an Gebäuden werden vorwiegend für Vögel, Insekten und Kleinsäuger zur Verfügung gestellt [1].
Nisthilfen helfen nur dann, wenn geeignete Lebensräume und die spezifischen Nahrungsressourcen in der unmittelbaren Umgebung vorhanden sind.
Potenzial
Da im Siedlungsgebiet natürliche Nist- und Brutplätze selten sind, können mit künstlichen Nisthilfen viele Vögel gefördert werden.
Dank dem warmen Mikroklima, kleinräumiger Strukturierung und einem oftmals hohen Ressourcenangebot kann das Siedlungsgebiet ausserdem wertvolle Inseln für Wildbienen bieten. Das Potenzial des Siedlungsgebietes ist für die Förderung der Wildbienen sehr hoch – aber bei weitem noch nicht ausgeschöpft [4]. Durch die Bereitstellung von Nisthilfen können gewissen Wildbienenarten zumindest ein Teil der nötigen Lebensraumstrukturen zur Verfügung gestellt werden.
Neben Vögeln und Insekten können auch Kleinsäuger wie Siebenschläfer, Haselmaus und Fledermäuse mit Nisthilfen gefördert werden [1]. Dabei gilt es, das potenzielle Vorkommen der Arten zu überprüfen.
Typische Tiere
Nisthilfen sind wichtige Förderelemente für Tiere im Siedlungsgebiet. Wichtig sind jedoch auch weitere Lebensräume, die naturnahe gestaltet sind.
Vögel
Mehlschwalbe (Delichon urbicum), Rauchschwalbe (Hirundo rustica), Mauersegler (Apus apus), Blaumeise (Cyanistes caeruleus), Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros), Turmfalke (Falco tinnunculus)
Wildbienen
Grosse Wollbiene (Anthidium manicatum), Gemeinde Pelzbiene (Anthophora plumipes), Rote Mauerbiene (Osmia bicornis), Gehörnte Mauerbiene (Osmia cornuta), Lauch-Maskenbiene (Hylaeus punctulatissimus), Furchenbiene (Halictus scabiosae)
Säugetiere
Siebenschläfer (Glis glis), Weissrandfledermaus (Pipistrellus kuhlii), Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii), Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus)
Standort
Der Standort von Nisthilfen ist abhängig von den zu fördernden Arten:
Vögel
Nisthilfen können beispielsweise an Fassaden, auf Balkonen, in Gärten, Obst- und Parkanlagen, Wäldern oder am Rand von Feuchtgebieten angebracht werden.
Einfluglöcher sind möglichst gegen Osten oder Südosten auszurichten, damit sie besser vor Witterungseinflüssen geschützt sind. Die Einflugöffnung sollte frei zugänglich sein (z.B. keine Äste davor).
Nisthilfen sollten tagsüber im Schatten oder mindestens im Halbschatten hängen. Insbesondere für standorttreue Arten wie Mauersegler oder Mehlschwalben ist es essenziell, dass die Nisthilfen langfristig bestehen.
Nisthilfen an Gebäuden sollten so platziert werden, dass keine Verschmutzungen durch Kot in Aufenthaltsbereichen (z.B. Balkone, Sitzplätze) entstehen oder sich Bewohner*innen durch die Geräusche von Vögeln gestört fühlen (z.B. in der Nähe von Schlafzimmerfenstern).
Bei der Standortwahl gilt zudem zu beachten, dass die Nisthilfen für eine allfällige Reinigung gut erreichbar sind. Mit Ausnahme von Seglerkästen ist dies in der Regel einmal jährlich zwischen Oktober und Februar der Fall.
Insekten
In der Schweiz leben über 600 Wildbienenarten [5]. Trotz ihrer Vielfalt stellen sie drei gemeinsame Ansprüche an geeignete Lebensräume:
- Blumen- und blütenreiche Flächen (z.B. Blumenwiese, Wildhecke, Obstbaum), die gut miteinander vernetzt sind
- Eher warme, meist besonnte (südost- bis südwestexponierte) Plätze für die Brut
- Artspezifische Baumaterialien (Sand, Erde, Lehm, Harz, Blätter, Pflanzenwolle), um die Brutplätze zu bauen oder die Brutröhrchen auszustatten und zu schliessen
Viele Wildbienenarten haben eine sehr enge Bindung an einen bestimmten Ort. Die meisten Wildbienen verbringen den grössten Teil ihres Lebens als Larve, Vorpuppe oder Puppe in der Brutzelle, wobei die meisten Arten als Ruhelarve überwintern. Darum ist es wichtig, dass die Eiablageplätze von Wildbienen möglichst ungestört sind [4].
Fledermäuse
Fledermäuse kommen in sämtlichen Lebensräumen vor: Über Gewässern, in Wäldern und auf Wiesen wie auch im Siedlungsraum. Ihre Tagesquartiere befinden sich in Dachböden, Spalten von Gebäuden oder in Baumhöhlen.
Alle einheimischen Fledermäuse sind Insektenfresser, einige Arten ernähren sich auch von Spinnen und Wasserfledermäuse ausnahmsweise von kleinen Fischen.
Da ihre Nahrungsgrundlage in der kalten Jahreszeit nicht in genügender Menge vorkommt, machen die Fledermäuse hierzulande einen Winterschlaf. Dazu suchen sie unterirdische Quartiere oder Hohlräume von Bäumen oder Gebäuden auf, die eine konstante Temperatur von 4-12 °C aufweisen [1].
Fledermäuse sind gefährdet und nicht nur in der Schweiz, sondern in ganz Europa geschützt. Ihre Quartiere dürfen nicht zerstört werden und es ist verboten, sie zu töten, einzufangen oder zu verletzen.
Bei Sanierungen oder Abrissen von Gebäuden sorgt das Vorkommen von Fledermäusen oft für Interessenskonflikte, die gelöst werden müssen. Dabei ist die Umsiedlung der Fledermäuse keine Option, da sie immer wieder dieselben Quartiere nutzen.
Aufgrund ihrer hohen Anforderungen an das Mikroklima der Unterschlüpfe und einem optimalen Schutz vor Frassfeinden wählen sie ihre Quartiere sehr sorgfältig aus und sind auf deren dauerhaftes Bestehen angewiesen.
Zielbild
Nisthilfen für Vögel können entweder selbst gebaut werden oder sind im Handel erhältlich. Abhängig von der Art, die gefördert werden soll, gilt es den geeigneten Nisthilfetyp (Grösse, Material, Öffnung etc.) zu beschaffen.
Für Insekten sollen Netzwerke von blüten- und kleinstrukturreichen Grünflächen aller Grössen geschaffen werden, damit Wildbienen geeignete Lebensräume mit den notwendigen Ressourcen vorfinden. Oberste Priorität hat die Verbesserung des Nahrungsangebots (Pollen und Nektar), gefolgt von der Schaffung geeigneter Nistplätze (z.B. künstliche Nisthilfen, hohle Pflanzenstängel, markhaltige Stängel, Totholz).
Bei der Pflanzenwahl soll darauf geachtet werden, dass einheimische Pflanzen verwendet werden, die für ein kontinuierliches Blütenangebot von Spätwinter bis Herbst sorgen [4].
Wenn immer möglich sollten Einschlupflöcher für Fledermäuse am Gebäude erhalten oder erstellt werden. Diese bieten ihnen oft optimale Bedingungen für die Jungenaufzucht oder den Winterschlaf.
Künstliche Quartiere für Fledermäuse können entweder selbst gebaut werden oder sind im Handel erhältlich. Abhängig von der Art, die gefördert werden soll, gilt es den geeigneten Typ zu beschaffen.
Planung
-
Gebäudeintegrierte Nisthilfen prüfen
-
Naturnahe Lebensräume in unmittelbarer Umgebung planen
-
Nisthilfen an zu fördernden Arten anpassen
Massnahmen im Detail
Die Planung von Nisthilfen ist abhängig von den Tiergruppen, die gefördert werden sollen.
Vögel
Bei Bestandsgebäuden oder in Grünräumen bieten sich externe Nisthilfen an. Bei Neubauten und Sanierungen hingegen sind gebäudeintegrierte Lösungen (z.B. für Mauersegler) eine gute Möglichkeit, da sie besser in das Gestaltungskonzept integriert werden können.
Nisthilfetypen
Abhängig von den zu fördernden Arten sind unterschiedliche Nisthilfen einzuplanen.
Höhlenbrüter
Grösse des Kastens und Fluglochs ist entscheidend für die zu fördernde Art
Mögliche Arten: Meisen, Sperlinge, Kleiber
Halbhöhlenbrüter
Halboffene Nistkästen
Mögliche Arten: Hausrotschwanz, Grauschnäpper, Bachstelze
Nistrinde
Nistkasten ohne Flugloch, sondern mit einem seitlichen Einschlupfloch
Mögliche Arten: Garten- und Waldbaumläufer
Seglerkasten
Idealerweise mehrere Seglerkästen nebeneinander montieren, Höhe abhängig von den zu fördernden Arten
Mögliche Arten: Mauer- und Alpensegler
Schwalbennester
V.a. am Siedlungsrand und in ländlicheren Umgebungen ideal
Mögliche Arten: Mehl- und Rauchschwalbe
Turmfalkennester
Idealerweise an hohen Gebäuden, mit genügend Abstand zu Seglerkolonien
Mögliche Arten: Turmfalke
Anzahl Nisthilfen
Die Zahl der Nisthilfen richtet sich danach, wie viele Vögel (halb-)höhlenbrütender Arten im betreffenden Gebiet Nahrung und Unterschlupf finden und welche Arten gefördert werden sollen. Grundsätzlich gilt die folgende Faustregel: Je unterschiedlicher die Lochgrössen der Nisthilfen sind, desto mehr Vogelarten können davon profitieren und umso mehr Nistkästen sind sinnvoll. Die Schweizerische Vogelwarte Sempach hält folgende Richtwerte fest [2]:
- Garten: Eine Nisthilfe an jedem zweiten Baum. Nistkästen, die nicht mit Nestern belegt sind, werden teilweise als Übernachtungsplätze benutzt.
- Obstgärten und Wald: bis 30 Stück pro 10 Hektaren.
- Koloniebrüter: stets mehrere Nisthilfen anbieten
Bezug der Nisthilfen
Vogelnistkästen sind im Handel erhältlich. Dabei werden auch Produkte angeboten, welche die Ansprüche der zu fördernden Vogelarten nicht erfüllen. Es empfiehlt sich, Vogelnistkästen bei entsprechenden Fachstellen wie beispielsweise der Schweizerischen Vogelwarte oder über die Bezugsquellen von BirdLife Schweiz zu beschaffen.
Alternativ können sie auch selbst gebaut werden. Dabei gilt es die folgenden Punkte zu beachten [2]:
- Spezifische Masse für die unterschiedlichen Vogelarten beachten. Weitere Informationen dazu liefert das Merkblatt «Nistkästen für Höhlenbrüter» auf Seite 2.
- Ideal: 29 mm dickes, ungehobeltes Fichten- oder Tannenholz
- Sperrholz oder Pressplatten sind ungeeignet, weil sie zu wenig atmungsaktiv sind
- Schrauben anstelle von Nägeln verwenden
- Aussenfläche bei Bedarf nur mit biologischen Produkten (z.B. Leinöl) gegen Feuchtigkeit, Pilz- oder Insektenbefall schützen
- Einflugloch schräg, nach innen ansteigend bohren, damit kein Regen eindringt
- Ein verzinktes Blechplättchen mit gut abgeschliffenen Kanten rund um das Einflugloch schützt vor Spechten.
Insekten
Für die Förderung von Wildbienen gilt es primär, die folgenden Grundsätze zu beachten [4]:
- Bestehende blüten- und/oder kleinstrukturreiche Flächen (z.B. Ruderalvegetation, Blumenwiese, Sandbeet) möglichst erhalten
- Offene und vegetationsarme Bodenstellen weder versiegeln noch zusätzlich begrünen, insbesondere wenn sie gut besonnt sind
- Vielfältige Angebote von Nahrungs- und Nistressourcen innerhalb weniger hundert Meter anbieten, denn die Mehrheit der Wildbienen fliegt für die Nahrungssuche nicht weiter als 100–300 m
Hohlraumnistende Wildbienenarten
Ungefähr ein Fünftel der mitteleuropäischen Wildbienenarten nistet in bereits vorhandenen Hohlräumen. Sie bauen ihre Brutstätten in Käferfrassgängen im Totholz, nisten in hohlen Pflanzenstängeln, Mauer-, Fels- oder Erdspalten oder benutzen verlassene Schneckenhäuschen.
Damit möglichst viele verschiedene Wildbienenarten gefördert werden können, sollen die zur Verfügung gestellten Strukturen möglichst vielfältig sein. Die im Handel angebotenen «Wildbienenhotels» können nur einen Teil der oben genannten Strukturen imitieren und werden nur von ein paar wenigen Arten besiedelt – ihr Nutzen für die Wildbienenförderung ist sehr beschränkt [6].
Bodennistende Wildbienen
Rund die Hälfte der mitteleuropäischen Wildbienenarten legt ihre Nester in offenen, gut besonnten Böden mit lückiger Vegetation an.
Beliebt sind magere Bereiche in Böschungen, Blumenwiesen und -rasen, offene Bodenstellen an Mauern oder Hauswänden, unversiegelte Fusswege, offene Fugen zwischen Gehwegplatten oder wenig beanspruchte Randbereiche von Blumen- und Gemüsebeeten.
Wichtig ist, dass die Stellen sonnenexponiert und der Boden nicht allzu feucht oder gar nass ist [6]. Für die Wahl des Nistplatzes sind bestimmte abiotische Eigenschaften des Nistsubstrates wie gute Grabfähigkeit, rasche Erwärmung und passende Feuchtigkeit entscheidend [4].
Fledermäuse
Um Fledermäuse zu fördern, sollten bestehende Sommer- und Winterquartiere geschützt werden, da Fledermäuse sehr standorttreu sind.
Wenn Fledermäuse am Gebäude gefördert werden, können bei Neu- oder Umbauten Quartiere ins Gebäude integriert werden. Dazu können beispielsweise Teilbereiche unter dem First als «Fledermaus-Dachboden» gestaltet werden oder künstliche Spaltenquartiere in oder an die Fassade angebracht werden.
Neben der Bereitstellung von optimalen Quartieren sind insektenreiche Lebensräume ein zentraler Bestandteil der Fledermausförderung. Daher sollten in kurzer Distanz zum Quartier naturnahe und biodiverse Lebensräume erstellt oder erhalten werden.
Realisierung
-
Artspezifische Nisthilfen umsetzten
-
Naturnahe Lebensräume in unmittelbarer Umgebung realisieren
Massnahmen im Detail
Die Realisierung von Nisthilfen ist abhängig von den Tiergruppen, die gefördert werden sollen.
Vögel
Bei der Montage gilt es die folgenden Punkte zu beachten:
- Für kleinere Singvogelarten liegt die Idealhöhe zwischen 1.8-3 m. Detailliertere Informationen zur empfohlenen Aufhänge-Höhe liefert das Merkblatt «Nistkästen für Höhlenbrüter» auf Seite 4.
- Nisthilfen an einem Aststummel aufhängen. Sie können gegen den Stamm lehnen oder an windgeschützten Orten frei an einem Seitenast hängen. Dadurch bieten sie einen besseren Schutz vor Hauskatzen.
- Zur Montage Drahtbügel oder Plastikkordeln verwenden und an lebenden Bäumen auf Nägel oder dünne Drähte verzichten (Verletzungsgefahr).
Insekten
Die Fördermassnahmen für Wildbienen unterscheiden sich abhängig von deren Niststrategie.
Hohlraumnistende Wildbienenarten
Hartholzblöcke
- Tierarten: Für Wildbienenarten, die ihre Brutzellen natürlicherweise in Käferfrassgängen in besonntem Totholz anlegen (z.B. Lauch-Maskenbiene (Hylaeus puntulatissimus), Hahnenfuss-Scherenbiene (Chelostoma florisomne))
- Konstruktion: Entrindete, unbehandelte und trocken gelagerte Blöcke aus Hartholz (Eiche, Buche, Obst, Esche) mit Bohrgängen von 5 bis 10 cm Tiefe und 3 bis 10 mm Durchmesser. Gänge quer zur Holzmaserung und nicht ins Stirnholz bohren; ab einem Durchmesser von 5 mm einen Mindestabstand von 2 cm; Oberfläche der Holzblöcke am Schluss mit Sandpapier schleifen
- Die Mehrheit der mitteleuropäischen Wildbienenarten nutzt Bohrgänge von 4 bis 7 mm Durchmesser
- Grösse und Form der Holzreste spielen keine Rolle
- Nadelholz (Fichte, Kiefer, Weisstanne) ist nicht geeignet
- Standort: Sonnige, regengeschützte Orte in östlicher-südöstlicher Exposition
- Montage: Waagrechte Ausrichtung der Nestgänge und freie Zugänglichkeit; die untersten Bohrgänge sollten mind. 0.5 m vom Boden entfernt sein
- Pflege: Ein Teil der alten Nestgänge sollte regelmässig neu ausgebohrt werden (sofern unbewohnt) oder durch neue Nisthilfen ersetzt werden
Hohle Pflanzenstängel
- Tierarten: Für Wildbienenarten, die ihre Brutzellen natürlicherweise in Käferfrassgängen anlegen (z.B. Rote Mauerbiene (Osmia bicornis), Gehörnte Mauerbiene (Osmia cornuta))
- Konstruktion: Hohle Pflanzenstengel (z.B. Bambus, Karde, Distel, Schilf); besonders geeignet ist Bambus, weil die stark verholzten Wände ein Aufhacken durch Meisen oder Spechte erschweren. Bambusrohr mit einem Innendurchmesser von 3 bis 10 mm direkt hinter einem Knoten durchsägen, anschliessend mit einem starken Draht den Innenraum von Mark und Markresten säubern
- Standort: An gut besonnten Wänden, Pfosten oder auf einer horizontalen Unterlage
- Montage: 10 bis 25 cm lange Bambusstücke mit Draht zusammenbinden, in die Löcher von Lochziegeln stecken oder in einer Konservendose bündeln
- Pflege: Regelmässig neue Nisthilfen anbieten
Markhaltige Stängel
- Tierarten: Für wenige Wildbienenarten, die ihre Nestgänge im Mark selber ausnagen (z.B. Dreizhan-Stängelbiene (Hoplitis tridentata), Gewöhnliche Keulhornbiene (Ceratina cyanea))
- Konstruktion: Markhaltige Stängel (z.B. von Brombeeren, Himbeeren, Heckenrosen, Königskerzen, Disteln, Kletten, Beifuss, Holunder); viele Wildbienenarten können die verholzte Stängelwand nicht durchnagen und sind auf Bruchstellen angewiesen. Dürre und nach unten gerichtete Brombeerranken kappen, letztjährige Stängel von Königskerzen und Disteln unter den Fruchtständen in einer Höhe von 0.5 bis 1 m durchschneiden und die Pflanze stehen lassen; alternativ die Stängel zu 0.5 bis 1 m langen Stücken zurechtschneiden
- Montage: Stängelstrukturen stehen lassen oder Stücke an gut besonnten Stellen einzeln in den Boden stecken resp. in vertikaler Position an Pfosten, Gartenzäunen oder zwischen gespannten Drähten fixieren
- Pflege: Stängel den Winter über aufrecht halten, damit die in den Stängeln überwinternde Brut nicht durch die erhöhte Feuchtigkeit in Bodennähe verpilzt
Totholz
- Tierarten: Für wenige Wildbienenarten, die ihre Nestgänge in morsches Totholz nagen (z. B. Grosse Holzbiene (Xylocopa violacea), Schwarzbürstige Blattschneiderbiene (Megachile nigriventris))
- Konstruktion: Morsche, halbverrottete Äste oder Baumstrünke von Obstbäumen, Pappeln oder Fichten
- Montage: Einzeln aufstellen oder zu einem Stapel schichten
- Standort: An sonnigen Stellen
- Pflege: Neues Totholz anbieten, wenn der Verwitterungsprozess zu stark fortgeschritten ist [4]
Bodennistende Wildbienenarten
Umfangreiche Informationen zum Bau von Sandnisthilfen für bodennistende Wildbienenarten liefert die Broschüre des Fördervereins «Natur im Siedlungsraum». Informationen zum Bezug von Sand sind beispielsweise bei der Bienenfachstelle des Kantons Zürich zu finden.
Fledermäuse
Spaltenquartier
Folgende Kriterien müssen für ein ideales Spaltenquartier eingehalten werden:
- Griffige Landestelle unterhalb oder seitlich der Einschlupföffnung
- Spalt von 1.5 bis 2 cm Höhe, 5 bis10 cm Breite
- Sommerquartiere: Warm, keine Zugluft, ruhig, dunkel
- Winterquartiere: Kalt aber frostfrei, feucht, ruhig und dunkel
- Ungehinderter Wegflug vom Gebäude
- Praktisch störungsfrei (insbesondere im Winter, damit die Fledermäuse nicht aufwachen)
Dachboden
Um einen idealen Dachboden für Fledermäuse zur Verfügung stellen zu können, gilt es folgende Kriterien einzuhalten:
- Einschlupföffnungen und Einflugmöglichkeiten in den Dachboden erstellen
- z.B. durch offene Fenster, Mauerlücken, grössere Durchlässe und Dachfenster
- mind. 50 cm breit, 11 cm hoch; falls Feinde wie Marder oder Katzen eindringen können, sollten alternativ Einschlupfschlitze von mind. 6 bis 20 cm Breite und 1.5 bis 3 cm Höhe eingerichtet werden
- Griffige Landestellen vor und hinter den Einschlupföffnungen
- Keine Zugluft, warm, dunkel
- Raue und griffige (sägerohe) Balken und Dachlatten
- Geeignete Spalten
- Ungehinderter Wegflug vom Gebäude
- Praktisch störungsfrei
- Geschützt vor Mardern, Falken, Eulen, Katzen
- Balken und Dachlatten nur mit fledermausverträglichen Holzschutzmitteln streichen oder mit Heissluftverfahren behandeln
Fledermauskeller
Folgende Kriterien führen zu einem idealen Fledermauskeller :
- Ein- und Ausflugsöffnungen, durch die Fledermäuse kriechen oder fliegen können (z. B. offene Fenster, Mauerlücken, Schlitze in Türen)
- Öffnungen: Mind. 50 cm breit, 11 cm hoch
- Hohe Luftfeuchtigkeit (85 bis 100 %)
- Raumtemperatur darf nur selten die Nullgradgrenze erreichen (3 bis 9 °C)
- Dunkel, zugluftfrei
- Geeignete Hangplätze: Vorsprünge und Spalten
- Störungsfrei, kein Zugang für Raubtiere (Marder, Katzen)
Pflege
-
Jährliche Reinigung von Vogelnistkästen
-
Lebensräume und Umgebung naturnah und extensiv pflegen
Massnahmen im Detail
Die Pflege von Nisthilfen ist abhängig von den Tiergruppen, die gefördert werden sollen.
Massnahmen naturnahe Pflege im Jahresverlauf
Vögel
Nach der Beschaffung und Installation beschränkt sich der Aufwand auf die jährliche Reinigung der Nisthilfen und ist entsprechend gering.
Nisthilfen werden ausserhalb der Brutzeit zwischen September und Ende Januar gereinigt. Auf Kontrollen der Nisthilfen während der Brutzeit gilt es zu verzichten, um die Brut und Aufzucht der Jungvögel nicht zu stören. Teilweise werden Nisthilfen von Tieren wie beispielsweise Siebenschläfern zur Überwinterung benutzt, die dann nicht gestört werden dürfen. Ebenfalls ist bei den Pflegearbeiten Vorsicht geboten, weil teilweise auch Hornissen oder Wespen die Nistkästen nutzen.
Nisthilfen sollten jährlich gereinigt werden. Ausnahme bilden Schwalben-Kunstnester (alle 2 Jahre) sowie Segler- und Dohlenkästen (alle 3 bis 5 Jahre, sofern zugänglich).
Bei allen Nisthilfen mit Ausnahme der Segler wird das Nest entfernt, um Platz für ein Neues zu schaffen und den Druck durch allfällige Parasiten zu verhindern [1]. Im Normalfall reicht für die Reinigung trockenes Ausbürsten, bei starkem Parasitenbefall kann die Nisthilfe mit einer brennenden Zeitung ausgeräuchert oder mit heissem Schmierwasser ausgespült werden (anschliessend gut trocknen lassen) [2].
Insekten
Folgende Punkte müssen bei der Pflege von Insektennisthilfen beachtet werden:
- Profile und Kleinstrukturen möglichst naturnah und extensiv pflegen
- Einsatz von „tierschonenden“ Geräten wie Balkenmäher, Sense, Rechen oder Handarbeit. Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und Dünger
- Ungestörte Bereiche zulassen
- Bereiche von Wiesen, Rasen und Krautsäumen über den Winter stehen lassen, weil sie wichtige Überwinterungsplätze bieten
- Regelmässig neue Nistplätze (z.B. Totholz, hohle und markhaltige Pflanzenstängel) anbieten
Fledermäuse
Die Pflege von Fledermausquartieren ist sehr extensiv. Quartiere müssen in der Regel nicht gereinigt werden.
Müssen Arbeiten ausgeführt werden, ist dies während der Abwesenheit der Fledermäuse und in Absprache mit Fachpersonen zu tun.
Rückbau
-
Wiederverwendung von Material prüfen
-
Eingriffe zeitlich auf vorkommende Arten abstimmen
Massnahmen im Detail
Der Rückbau von Nisthilfen ist abhängig von den Tiergruppen, die gefördert werden sollen.
Vögel
Rückbau Nisthilfen sollten möglichst dauerhaft an einem Ort bestehen. Falls dies nicht möglich ist, gilt es zu prüfen, ob die Nisthilfe an einem anderen Ort in unmittelbarer Nähe montiert werden kann.
Die Eingriffe sollten zwischen September und Februar (ausserhalb der Brutzeit) stattfinden, damit keine Vögel gestört werden.
Falls keine Wiederverwendung möglich ist oder das Holz bereits stark zersetzt ist, kann es (sofern unbehandelt) als Grüngut entsorgt werden. Dabei gilt es die Vorschriften der zuständigen Gemeinde/Stadt zu beachten. Bei Nistkästen aus anderen Materialien gilt es abzuklären, ob sie bei den regionalen Recyclingzentren entsorgt werden müssen.
Insekten
Nistplätze für Wildbienen sollten möglichst dauerhaft an einem Ort bestehen. Wenn ein von Wildbienen besiedelter Nistplatz umgegraben oder rückgebaut wird, werden sie unabhängig von der Jahreszeit gestört.
Je nachdem, welche Wildbienenarten den Nistplatz nutzen, sind Brutaktivitäten von Mitte März bis Mitte Oktober möglich. Ausserhalb dieses Zeitraums entwickeln sich in den Nestern am Boden oder in den Hohlräumen von Holz/Pflanzenstengeln die nächste Generation und überdauert den Winter in einem Ruhestadium.
Fledermäuse
Wurden Fledermäuse in dem rückzubauenden Gebäude nachgewiesen, muss mit der jeweiligen kantonalen Fachstelle Naturschutz Kontakt aufgenommen werden.
Da es sich um geschützte Arten handelt, können Ersatzmassnahmen verlangt werden. Diese sind artspezifisch. Dies bedeutet, dass die Massnahmen den Ansprüchen der Art genügen müssen, deren Quartier verlorengegangen ist. Ein Dachbodenquartier kann daher in der Regel nicht mit einem Fledermauskasten an der Fassade ersetzt werden kann.
Bestimmungen
Gesetzliche und planerische Grundlagen für die Planung, Realisierung, Pflege und Rückbau (kein Anspruch auf Vollständigkeit):
- Tierschutzgesetz (TSchG)
- Tierschutzverdung (TSV)
Quellen
Tschäppeler, S., & Haslinger, A. (2021). Natur braucht Stadt—Berner Praxishandbuch Biodiversität. Haupt Verlag.
Schmid, H. (2019). Merkblätter für die Vogelschutzpraxis: Nistkästen für Höhlenbrüter. Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz & Schweizerische Vogelwarte Sempach. vogelwarte.ch
Westrich, P. (2015). Wildbienen—Die anderen Bienen (5. Auflage). Pfeil.
Zurbuchen, A., & Müller, A. (2012). Wildbienenschutz – von der Wissenschaft zur Praxis. Zürich, Bristol-Stiftung; Bern, Stuttgart, Wien, Haupt. Bienen (5. Auflage). Pfeil.
Bundesamt für Umwelt BAFU. (2019). Wild und wertvoll. bafu.admin.ch
Bienenfachstelle Kanton Zürich. (2021). Nistplätze für Wildbienen. bienenfachstelle-zh.ch