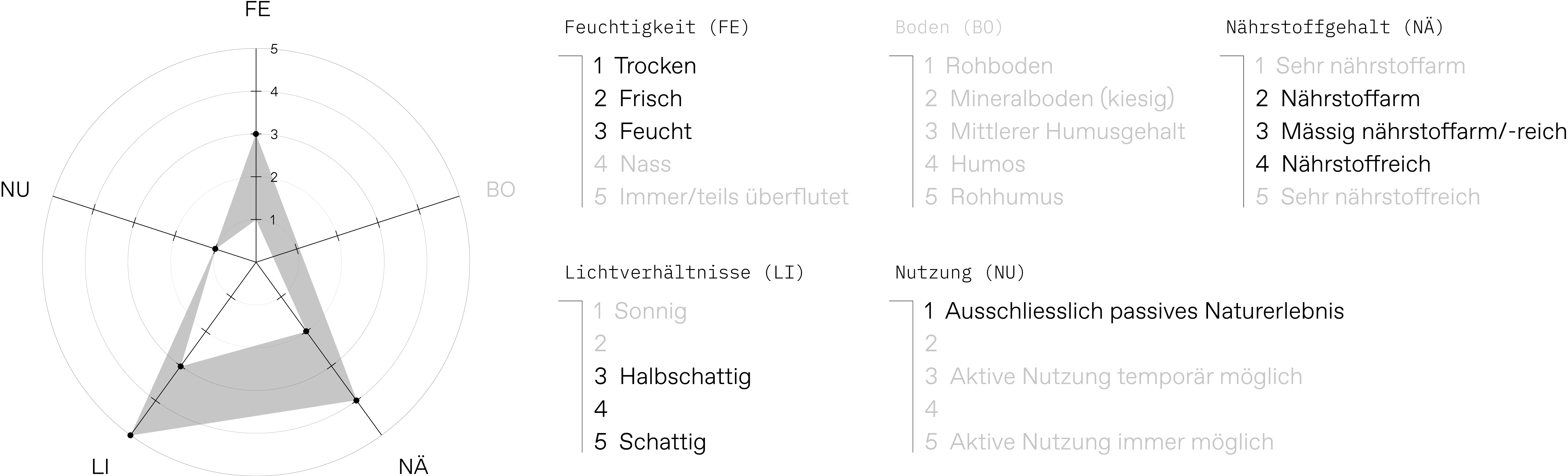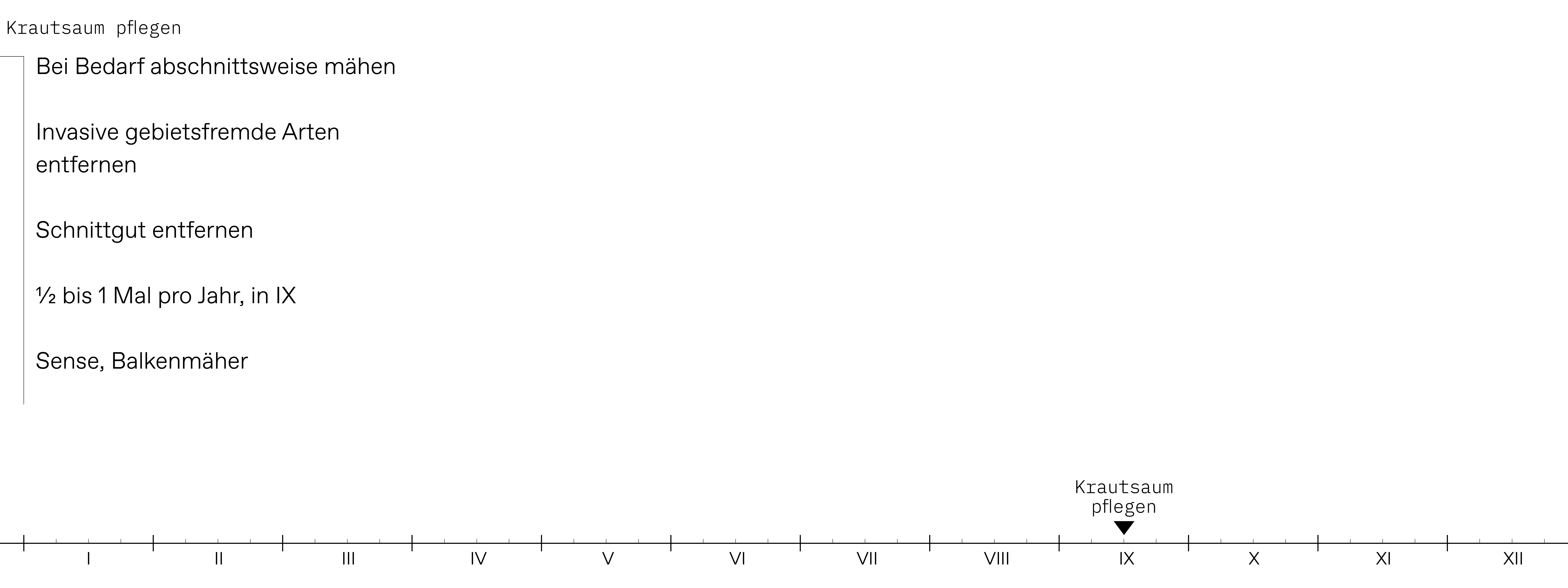In Kürze
Krautsäume sind wichtige Lebensräume für Insekten und Nahrungsquellen für zahlreiche Vögel und Säugetiere.
Anforderungen
Grundsätze
Mit der Erfüllung dieser Grundsätze wird die Biodiversität gefördert.
Pflege
Möglichst gesamte Fläche gemäss Prinzipien naturnahe Pflege
Alle 2 bis 3 Jahre abschnittsweise im September/Oktober mähen
> 10 cm Schnitthöhe
Invasive gebietsfremde Arten entfernen
Nutzung
Keine aktive Nutzung
Standort
Besonders wertvoll, wenn an sonnigen und nährstoffarmen Standorten
Entlang von anderen Strukturen oder Lebensräumen
Erhöhte Anforderungen
Mit der Erfüllung dieser erhöhten Anforderungen wird die Biodiversität noch stärker gefördert.
Mindestgrösse
> 50 cm breit, idealerweise 1 bis 3 m
Pflege
Gesamte Fläche gemäss Prinzipien naturnahe Pflege
Definition
Bei Krautsäumen handelt es sich um hohe, krautige, extensiv gepflegte Vegetationsstrukturen entlang von Hecken, Gewässern, Wald- und Wiesenrändern, Strassen, Mauern oder Zäunen.
Sie bilden Übergangsbereiche zwischen unterschiedlichen Lebensräumen wie Blumenrasen und Wildhecken und können wichtige ökologische Vernetzungskorridore darstellen [1].
Potenzial
Krautsäume sind aus ökologischer Sicht besonders wertvoll, wenn sie möglichst durchgehend und mit naturnahen Lebensräumen vernetzt sind und zusätzliche Versteck- und Überwinterungsmöglichkeiten in Form von Kleinstrukturen wie Holz- oder Steinhaufen angeboten werden [1].
Typische Pflanzen
Von Krautsäumen profitieren viele Pflanzen- und Tierarten. An feuchten Standorten können beispielsweise Pflanzen wie Wasserdost (Eupatorium cannabinum) oder Moor-Geissbart (Filipendula ulmaria) gefördert werden, an mässig feuchten bis mässig trockenen das Echte Johanniskraut (Hypericum perforatum) und an trockenen, besonnten Standorten die Acker-Glockenblume (Campanula rapunculoides) oder das Nickende Leimkraut (Silene nutans).
Feuchter Standort
Wilde Karde (Dipsacus fullonum), Wasserdost (Eupatorium cannabinum), Moor-Geissbart (Filipendula ulmaria), Gemeiner Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris), Echtes Seifenkraut (Saponaria officinalis), Rote Waldnelke (Silene dioica), Echte Wallwurz (Symphytum officinale)
Mässig feuchter bis mässig trockener Standort
Geissfuss (Aegopodium podagraria), Kleiner Odermennig (Agrimonia eupatoria), Knoblauchhederich (Alliaria petiolata), Wald-Bergminze (Calamintha menthifolia), Nesselblättrige Glockenblume (Campanula trachelium), Wirbeldost (Clinopodium vulgare), Echtes Johanniskraut (Hypericum perforatum), Dürrwurz-Alant (Inula conyzae), Gefleckte Taubnessel (Lamium maculatum), Grosse Brennnessel (Urtica dioica)
Trockener, besonnter Standort
Weidenblättriges Rindsauge (Buphthalmum salicifolium), Acker- Glockenblume (Campanula rapunculoides), Rapunzel-Glockenblume (Campanula rapunculus), Blutroter Storchschnabel (Geranium sanguineum), Nickendes Leimkraut (Silene nutans), Edel-Gamander (Teucrium chamaedrys), Lampen-Königskerze (Verbascum lychnitis)
Typische Tiere
Wildtiere profitieren von Krautsäumen als Rückzugs- und Überwinterungsorte. Zudem können Krautsäume sehr insektenreich sein und damit wichtige Nahrungsquellen für insektenfressende Vögel oder Säugetiere sein. Meist handelt es sich bei Krautsäume um Teillebensräume, dies bedeutet, dass viele Tierarten weitere Lebensräume benötigen, die naturnahe gestaltet sind.
Vögel
Distelfink (Carduelis carduelis), Grünfink (Carduelis chloris), Feldsperling (Passer montanus), Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus), Zilpzalp (Phylloscopus collybita), Sommergoldhähnchen (Regulus ignicapilla), Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla), Zaunkönig (Troglodytes troglodytes)
Säugetiere
Waldmaus (Apodemus sylvaticus), Hausspitzmaus (Crocidura russula), Igel (Erinaceus europaeus), Hermelin (Mustela erminea), Iltis (Mustela putorius), Rötelmaus (Myodes glareolus)
Amphibien
Erdkröte (Bufo bufo), Grasfrosch (Rana temporaria)
Reptilien
Blindschleiche (Anguis fragilis), Mauereidechse (Podarcis muralis)
Schmetterlinge
Tagpfauenauge (Aglais io), Kleiner Fuchs (Aglais urticae), Zitronenfalter (Gonepteryx rhamni), Schwalbenschwanz (Papilio machaon), Admiral (Vanessa atalanta), Distelfalter (Vanessa cardui)
Libellen
Blaugrüne Mosaikjungfer (Aeshna cyanea), Gebänderte Prachtlibelle (Calopteryx splendens), Vierfleck (Libella quadrimaculata)
Wildbienen
Gartenhummel (Bombus hortorum), Ackerhummel (Bombus pascuorum), Gewöhnliche Maskenbiene (Hylaeus communis), Rote Mauerbiene (Osmia bicornis)
Standort
An mageren und besonnten Standorten sind Krautsäume aus ökologischer Sicht besonders wertvoll [1].
Sie können aber grundsätzlich an allen Standorten angelegt werden, sofern sie stimmig ins Gestaltungs- und Nutzungskonzept integriert sind.
Zielbild
Abhängig vom Gestaltungs- und Nutzungskonzept können Krautsäume in unterschiedlichen Grössen und Formen angelegt werden.
Planung
-
Genügend grosse Flächen (> 0.5 m breit) auswählen
-
Einheimisches und standortgerechtes Saat- und Pflanzgut auswählen
-
Standortanalyse durchführen
Massnahmen im Detail
Krautsäume können entweder durch die Anpassung der Pflege oder durch eine bewusste Neuanlage erstellt werden.
Standort wählen
Ein Streifen von 50 cm Breite reicht für einen Krautsaum, ideal sind jedoch 1 bis 3 m. Mögliche Flächen finden sich entlang von Hecken, Zäunen, Mauern, Wegen und rund um kleine Gehölzgruppen.
Standortbedingungen analysieren
Um einen Krautsaum anzulegen müssen zuerst die Standortbedingungen analysiert werden. Genauere Informationen finden sich im Fachthema Pflanzenverwendung.
Grundsätzlich gedeihen jedoch blütenreiche Krautsäume am besten an süd- bis westexponierten Standorten
Pflanzen wählen
Die Pflanzenauswahl bei einer Neuanlage basiert auf der Standortanalyse.
Krautsäume können als Saatmischung gesät oder mit Wildstauden gepflanzt werden. Dafür werden 6 bis 8 Pflanzen pro Quadratmeter eingeplant. Stauden eignen sich besonders beim Anlegen eines Krautsaums entlang von bestehenden Hecken.
Genauere Informationen zur Pflanzenauswahl findet sich im Fachthema Pflanzenverwendung.
Realisierung
-
Je nach Standort Krautsaum neu anlegen oder Pflege umstellen
-
Einheimisches und standortgerechtes Saat- und Pflanzgut aussäen und/oder pflanzen
Massnahmen im Detail
Pflege anpassen
Die aktuelle krautige/wiesenartige Vegetation auf einem Streifen von mind. 50 cm (ideal 1 bis 3 m) wachsen lassen und nur noch einmal alle 2 bis 3 Jahre abschnittsweise im September/Oktober mähen.
Nicht mulchen. Schnittgut einige Tage auf der Fläche trocknen lassen und anschliessend entfernen (z.B. einen Heuhaufen damit anlegen).
Neuanlage
Informationen zur Beschaffung von Pflanzen und Saatgut, sowie die Pflanzung von Stauden finden sich im Fachthema Pflanzenverwendung. Die Ansaat von Krautsäumen
Informationen zu den nötigen Bodenvorbeitungen, Saat- und Pflanztechniken befinden sich im Fachthema Pflanzenverwendung und im Profil Staudenbepflanzung.
Entwicklungspflege
Bei einer Pflanzung von Stauden wird nach Bedarf gejätet. Genauere Informationen finden sich im Profil Staudenbepflanzung.
Die Entwicklungspflege von Ansaaten kann im Profil Blumenwiese gefunden werden.
Pflege
-
Krautsäume abschnittsweise mähen
-
Frühestens ab September mit Sense oder Balkenmäher mähen
-
Schnitthöhe > 10 cm
-
Invasive gebietsfremde Arten und unerwünschte Arten entfernen
Massnahmen im Detail
Krautsäume abschnittsweise und frühestens ab September mit einer Schnitthöhe von mind. 10 cm mähen und das Schnittgut entfernen (z.B. aufschichten)).
Die ersten 50 cm des Krautsaumes sind nur alle zwei Jahre auf verschiedensten Abschnitten zu mähen, damit Kleintiere auf ungemähte Abschnitte ausweichen können. Bei den übrigen Flächen des Krautsaums kann die Mahd je nach Wüchsigkeit angepasst werden.
Bei mageren Krautsäumen alle zwei bis drei Jahre, bei wüchsigeren öfter. Stellen, in denen viele Wildlinge vorkommen, sind öfters zu mähen.
- Invasive gebietsfremde Arten möglichst vor ihrer Samenreife fachgerecht entfernen [2][3]. Wird ein Saum häufiger als einmal jährlich gemäht oder gar gemulcht, verschwinden die typischen, wertvollen Saumarten. Umgekehrt führt eine zu geringe Pflege zu Verbuschung und Ausbreitung der Gehölze, wodurch die lichtbedürftigen Saumarten ebenfalls verschwinden [1].
- Geräte: Balkenmäher oder Sense. Verzicht auf Motorsense (Fadenmäher), weil sie Pflanzenrosetten beschädigen und Wildtiere in Bodennähe verletzen kann.
- Die Eidgenössische Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung ChemRRV gibt vor, dass in Streifen von drei Metern Breite entlang von Hecken und Feldgehölzen keine Pflanzenschutzmittel und keine Dünger eingesetzt werden dürfen.
Massnahmen naturnahe Pflege im Jahresverlauf
Rückbau
-
Wiederverwendung von wertvollen Stauden prüfen
Massnahmen im Detail
Wertvolle Stauden können ausgegraben und in anderen Profilen wie Staudenbepflanzungen oder Hochstaudenfluren wieder eingepflanzt werden.
Bestimmungen
Gesetzliche und planerische Grundlagen für die Planung, Realisierung, Pflege und Rückbau (kein Anspruch auf Vollständigkeit):
- Chemikalienverordnung (ChemV)
- Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV)
- Pflanzenschutzmittelverordnung (PSMV)
Quellen
Tschäppeler, S., & Haslinger, A. (2021). Natur braucht Stadt—Berner Praxishandbuch Biodiversität. Haupt Verlag.
Benz, R., Jucker, P., & Koller, N. (2021). Hecken—Richtig pflanzen und pflegen. https://agridea.abacuscity.ch/...
Brack, F., Hagenbuch, R., Wildhaber, T., Henle, C., & Sadlo, F. (2019). Mehr als Grün! – Praxismodule Naturnahe Pflege: Profilkatalog (Grün Stadt Zürich, Hrsg.). ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Forschungsgruppe Freiraummanagement (unveröffentlicht).