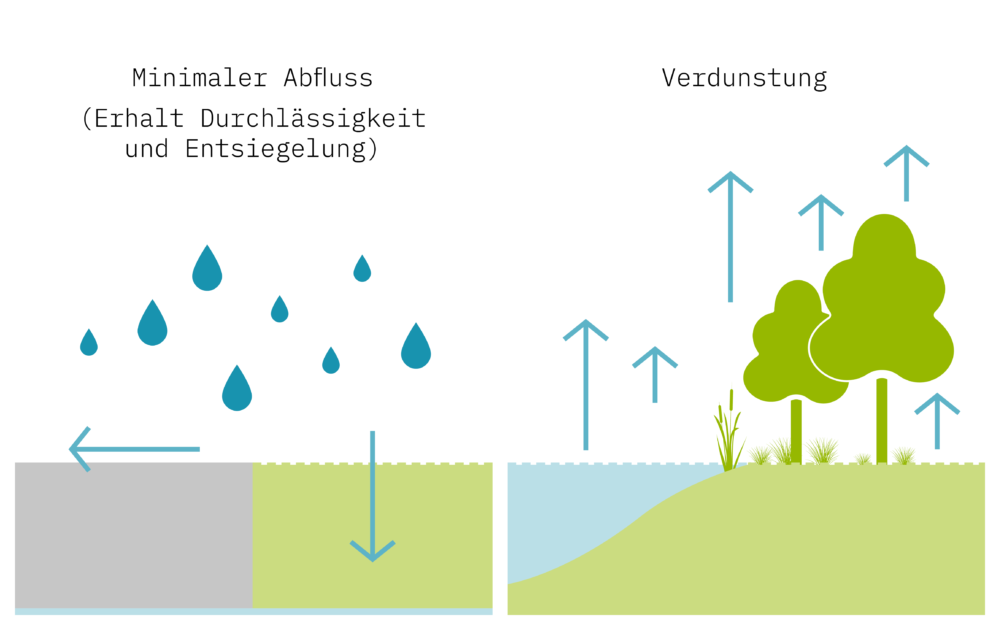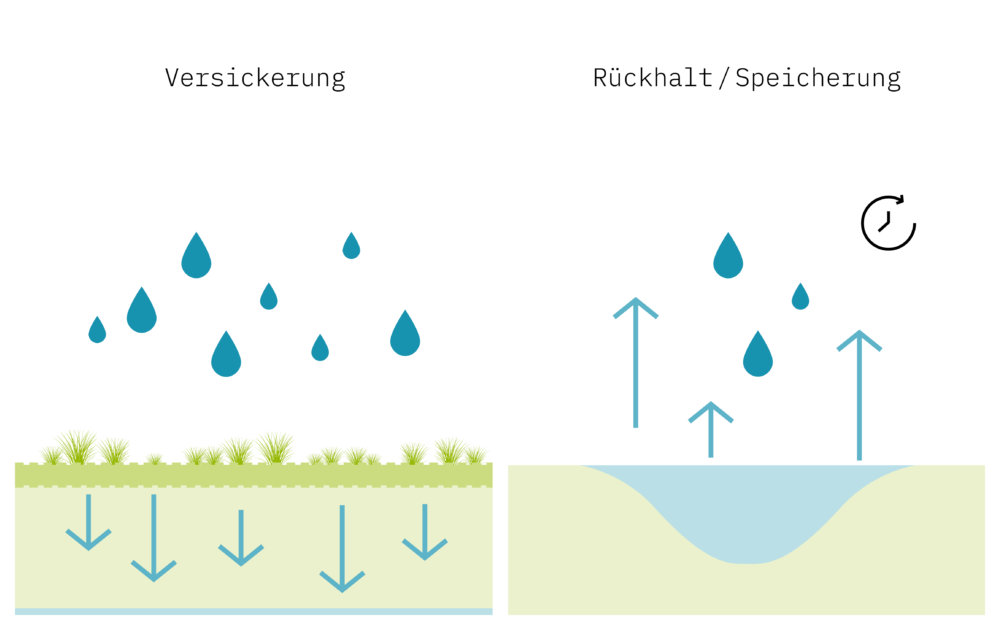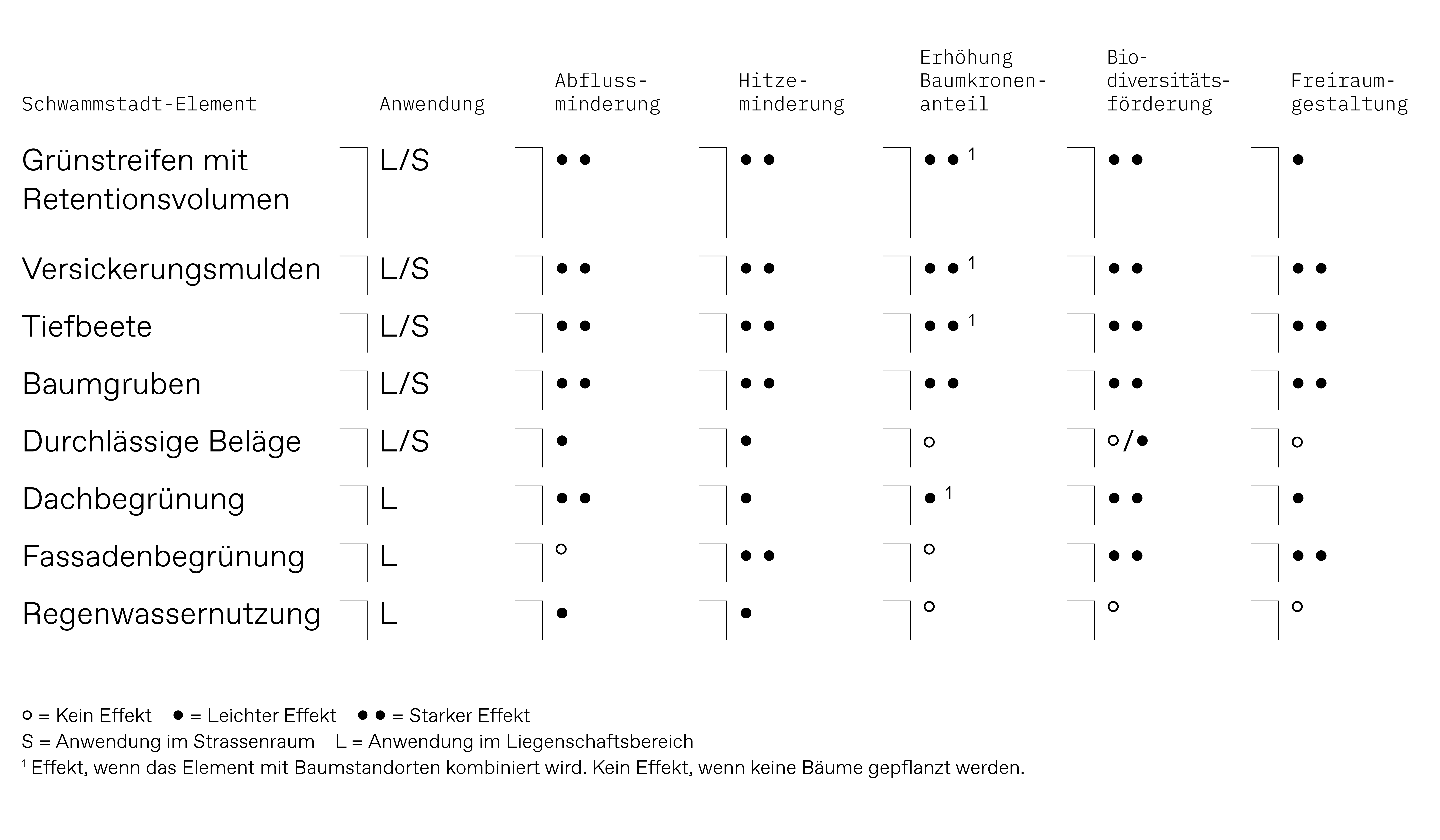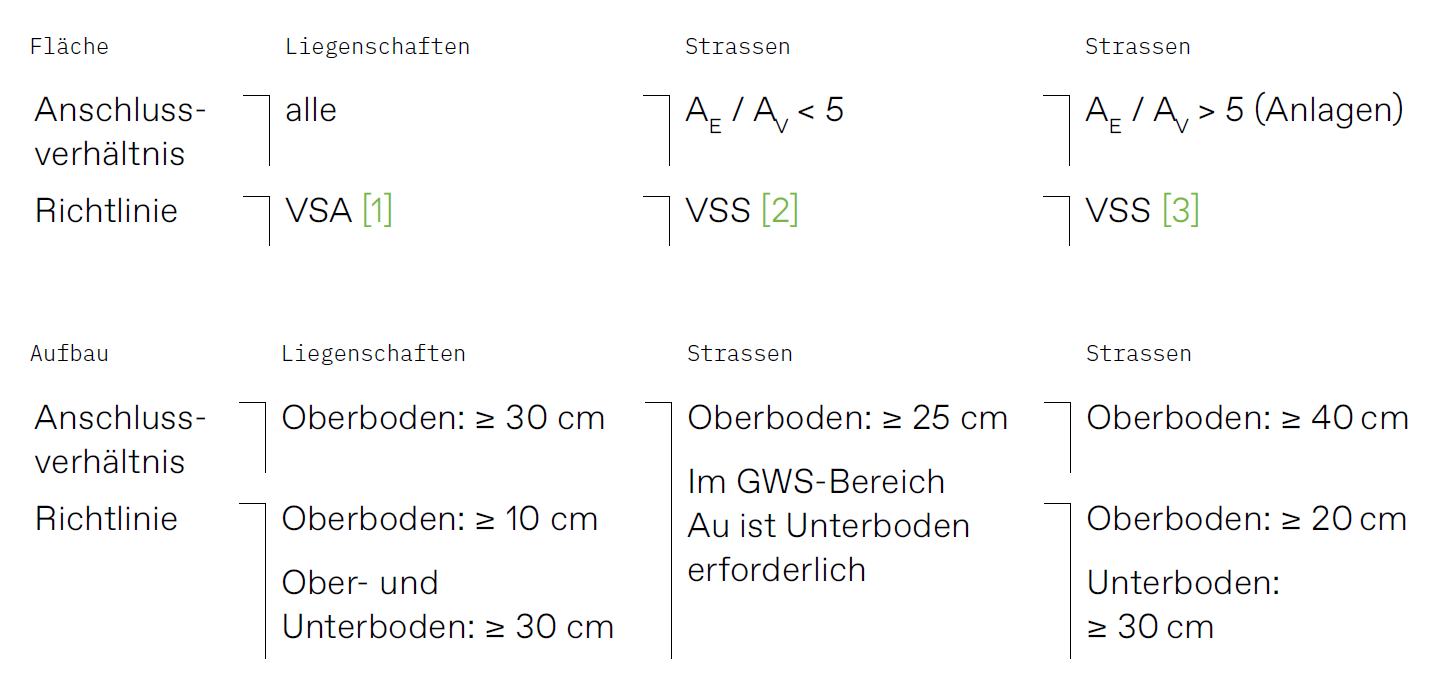In Kürze
Im Siedlungsgebiet gibt es aufgrund der vielen versiegelten Flächen bei Starkregenereignissen einen deutlich höheren Oberflächenabfluss als ausserhalb von bebauten Gebieten. Das Prinzip der Schwammstadt versucht dem entgegenzuwirken. Die Siedlungsgebiete sollen sich dabei, wie ein Schwamm, flexibel an die Veränderungen in der Umwelt anpassen.
Ziel der Schwammstadt ist es, ein möglichst grosser Anteil an Regenwasser lokal zurückzuhalten, versickern und verdunsten zu lassen. Dafür wird in den begrünten urbanen Flächen Niederschlagswasser oberflächennah gespeichert, so dass es von den Pflanzen genutzt und verdunstet werden kann.
Schwammstadt-Element Schulhaus Kreuzgut, Schaffhausen
Quelle: Grün Schaffhausen
Durch die Klimaveränderungen treten Ereignisse wie Starkregen, Hitzewellen und Trockenperioden häufiger auf. Dies ist nicht nur wissenschaftlich belegt, wir erleben dies in der Schweiz und in Europa gerade in den letzten Jahren in sehr eindrücklicher Weise. Deshalb ist es heute und in den kommenden Jahren und Jahrzehnten umso wichtiger, diese Phänomene in der kommunalen Planung zu berücksichtigen. Ziel ist es, verstärkt Massnahmen umzusetzen, die sowohl die Bevölkerung als auch die Infrastruktur vor solchen Extremereignissen schützen.
Schwammstadt-Prinzip
In Kontext der Klimaanpassung kann das Prinzip der «Schwammstadt» oder wassersensiblen Siedlungsentwicklung wichtige Funktionen erfüllen. Das im Siedlungsgebiet anfallende Regenwasser soll aufgefangen, lokal gespeichert und genutzt werden. Die Verdunstung und die Versickerung sollen der direkten Ableitung vorgezogen werden, wodurch der natürliche, lokale Wasserkreislauf unterstützt wird.
Die Möglichkeiten, Schwammstadt in Siedlungsgebieten umzusetzen, sind sehr vielfältig und reichen von Anlagen der Verdunstung, Versickerung (ober- und unterirdisch) hin zur Retention / Speicherung und ggf. auch Nutzung. Die Wahl der Schwammstadt-Elemente hängen von lokalen Randbedingungen ab.
Wirkungsfelder der Schwammstadt-Elemente
Schwammstadt-Elemente wirken auf mehreren Ebenen und haben vielfältige Effekte:
Abflussminderung
Schwammstadt-Massnahmen gehen einher mit einer durchlässigen Oberflächengestaltung und geförderter Verdunstungs- und Versickerungsleistung. Der natürliche Wasserhaushalt wird dadurch unterstützt, womit u.a. die Menge an abfliessendem Wasser reduziert wird.
Hitzeminderung
Die durch Schwammstadt-Massnahmen vielfach unterstützte Vegetation leistet einen Beitrag zur verstärkten Verdunstung und Beschattung der Umgebung. Damit kann das Mikroklima insbesondere an warmen bis heissen Sommertagen gekühlt und die Aufenthaltsqualität gefördert werden.
Erhöhung Baumkronenanteil
Bäume sind natürliche Klimaanlagen, die über Verdunstung und Beschattung die Umgebungstemperatur spürbar kühlen können. Je grösser der Baumkronenanteil in einer Stadt, desto mehr Kühlleistung ist vorhanden. Diverse Schwammstadt-Massnahmen werden oft in Kombination mit Baumpflanzungen angelegt, da sie die Vitalität der Bäume zusätzlich unterstützen.
Biodiversitätsförderung
Die naturnahe Begrünung bei Projekten mit Schwammstadt-Elementen kann einen Beitrag zur Biodiversitätsförderung leisten. Durch eine artenreiche, möglichst einheimische, standortgerechte, sowie klimaangepasste Vegetation kann die Diversität in Flora und Fauna gezielt gesteigert werden. Die naturnahe Pflege ist dabei ein weiterer wichtiger Faktor.
Freiraumgestaltung
Mit einer attraktiven Freiraumgestaltung kann eine deutliche Aufwertung erfolgen und das Wohlbefinden der Bevölkerung gesteigert werden. Öffentliche Flächen können für diverse Nutzer:innen attraktiv gestaltet werden, indem klimatische Bedingungen sowie das Erscheinungsbild gezielt berücksichtigt werden. Dabei können verschiedene Nutzungen geschickt kombiniert und überlagert werden (Multifunktionalität).
Wirkungsfelder der Schwammstadt-Elemente
Quelle: Toolbox Schwammstadt Stadt Schaffhausen
Es bestehen weitere Wirkungsfelder wie Grundwasserneubildung oder Starkregenvorsorge, welche an dieser Stelle nicht vertieft werden.
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über mögliche Schwammstadt-Elemente und die qualitative Beurteilung dieser in Bezug zu den Wirkungsfeldern.
Qualitative Beurteilung der Schwammstadt-Elemente in Bezug zu den Wirkungsfeldern
Quelle: Toolbox Schwammstadt Stadt Schaffhausen
Die Kombination und Vernetzung von Schwammstadt-Elementen in einem Siedlungsraum wird empfohlen, um die positiven Effekte zu verstärken.
Planung und Realisierung
Grundsätze
Frühzeitiges Einbeziehen des Regenwassers
Die Thematik Regenwasser ist so früh wie möglich im Planungsprozess zu beachten. So ist bereits in Testplanungen und Quartierplänen die Thematik Regenwasser zu verankern. Andererseits ist bei Bauprojekten sogleich bei der Bedürfnisformulierung (SIA Phase 11) in der Zieldefinition das Regenwasser zu integrieren. Im Baubewilligungswesen ist stark auf die Beantwortung der Fragen der Regenwasserbewirtschaftung zu achten.
Entwässerungskonzept
Bereits auf Stufe Machbarkeitsstudie ist der Flächenbedarf für Schwammstadt-Massnahmen verschiedener Varianten zu ermitteln. Der Umgang mit Regenwasser ist als Entscheidungskriterium für die Wahl der Bestvariante zu berücksichtigen.
Ab Stufe Vorprojekt ist ein Regenwasserbewirtschaftungskonzept zu erstellen, welches den Umgang mit Regenwasser definiert, Schnittstellen klärt und grobe Dimensionen der Elemente wiedergibt. Auch ein Betriebs- und Unterhaltskonzept ist frühzeitig zu erstellen.
Aufwendungen und Kosten
Je früher Schwammstadt-Massnahmen in einem Bauvorhaben integriert werden, desto geringer fallen Mehraufwendungen bei den Investitionskosten aus. Beim Betrieb und Unterhalt kann zusätzlicher Aufwand aufgrund von Schwammstadt-Massnahmen anfallen (z.B. Pflege der Vegetation statt ausschliesslich Reinigung von Asphaltflächen), wobei die Zuständigkeiten und das Budget entsprechend zu klären sind.
Bei einer frühzeitigen Berücksichtigung von Unterhaltsaspekten im Planungs- und Bauprozess können die Unterhaltskosten ebenfalls optimiert werden.
Einbezug von Fach- und Dienststellen
Betroffene Fach- und Dienststellen sind frühzeitig in die Planung informativ und/oder aktiv miteinzubeziehen. So können diverse Ansprüche frühzeitig abgeholt, Vorbehalte abgebaut und die Akzeptanz für Schwammstadt-Planungen erhöht werden. Dies gilt über den gesamten Prozess, von der Planung, über die Realisierung bis hin zu Betrieb und Unterhalt der Massnahmen.
Multifunktionalität
Gerade in dichten urbanen Gebieten ist es wichtig, die vorhanden Flächen multifunktional zu konzipieren und zu nutzen. Multifunktionale Lösungen erfüllen gleichzeitig auf der gleichen Fläche mehrere Funktionen. Eindimensionale Planungen, die Flächen vorsehen, die nur einen einzigen Nutzen ermöglichen, sind dabei möglichst zu vermeiden. Beispielsweise können Retentionsflächen bei Trockenwetter als Aufenthaltsraum oder Spielfläche, und bei Regenwetter als Volumen zur Zwischenspeicherung von Regenwasser dienen. Zudem können Retentionsflächen und andere Schwammstadt-Elemente gleichzeitig wertvolle Lebensräume für einheimische Flora und Fauna darstellen.
Sensibilisierung
Schwammstadt-Massnahmen können das Stadtbild dahingehend verändern, dass beispielsweise Wasser gewollt sichtbar gemacht wird. Dies kann Fragen aufwerfen über die Funktionstüchtigkeit des Entwässerungssystems. Durch die Information und Sensibilisierung der Bevölkerung können Vorbehalte abgebaut und die Akzeptanz erhöht werden.
Erfolgskontrolle und Monitoring
Um Erkenntnisse über die Funktionsweise der Schwammstadt-Elemente zu erlangen, ist frühzeitig ein Konzept zur Erfolgskontrolle und Monitoring aufzuzeigen. Dies kann bei kleineren Projekten einfach gehalten sein mit Sichtkontrollen der Vegetation (u.a. Baumvitalität) und Bodendurchlässigkeit nach starken Regenereignissen. Bei grösseren Projekten wird empfohlen, zusätzlich noch Messinstallationen zur Überprüfung des Wassereinstaus, Überlaufhäufigkeit einzubauen und ggf. auch Schöpfproben zur Überwachung der Reinigungsleistung des Bodenmediums durchzuführen.
Zulässigkeit Versickerung
Zu Beginn der Planung ist zu klären, was die Anforderungen an die Versickerung gemäss VSA Richtlinie Abwasserbewirtschaftung (2019) im Liegenschaftsbereich und der VSS-Normen für Strassen sind. Die Anforderungen sind abhängig von den folgenden lokalen Begebenheiten:
- Belastung des Regenwassers (Nutzung der beregneten Flächen, Oberflächenmaterialisierung, Verkehrsbelastung Strassen)
- Grundwasserschutzbereich (üB, Au, S1, S2, S3)
- Flurabstand zum Grundwasser
- Altlasten, belastete Standorte
Die Zulässigkeit der Versickerung von Regenwasser ist abhängig von der Herkunft des Wassers. Es wird bei den zu entwässernden Flächen zwischen Dach- und Fassadenflächen respektive Platz- und Verkehrsflächen unterschieden. Folgende Grundsätze gelten gemäss [1]:
- Versickerung in den Grundwasserschutzzonen S1 und S2 ist nicht zulässig.
- In der Zone S3 ist die Versickerung nur bei gering belastetem Wasser und mit einer Bodenpassage (biologisch aktive Bodenschicht zur Reinigung des Wassers) zulässig. Informationen und Anforderungen zur Bodenpassage sind in [1] zu finden.
- Für die Zonen Au und üB sind die Zulässigkeiten in den einzelnen Toolbox-Blättern zu finden. Wenn eine Versickerung nur mit Behandlung zulässig ist, wird spezifiziert, ob die Anlage der Anforderungsstufe Standard oder erhöht genügen muss. Details zu den Anforderungsstufen sind in Modul B, Kapitel 7 der VSA-Richtlinie zu finden [1].
- Der Flurabstand zum Grundwasser muss mindestens 1.0 m von der Sohle einer Versickerungsfläche betragen. Die planerische Grundlage kann im kantonalen GIS eingesehen werden.
- Für den Aufbau der Bodenschichten bei Versickerungsflächen gelten unterschiedliche Anforderungen je nach Art der Entwässerungsfläche und dem Anschlussverhältnis zwischen Entwässerungsfläche AE und Versickerungsfläche AV (AE/AV), siehe Tabelle. Ist dieses Verhältnis über 5, gilt die Versickerung als Anlage und ist bewilligungspflichtig.
Anforderungen an den Aufbau der Bodenschichten bei Versickerungsflächen:
Anforderungen Aufbau Bodenschichten bei Versickerungsflächen
Quelle: Toolbox Schwammstadt Stadt Schaffhausen
Des Weiteren ist die Sickerleistung des Bodens und des Untergrunds entscheidend für die Planung einer Versickerung. Schwammstadt-Elemente können auch bei schlecht sickerfähigem Untergrund umgesetzt werden, indem die oberen Bodenschichten als Speicher verwendet werden (geförderte Pflanzenverfügbarkeit des Wassers und Verdunstung).
Dimensionierung
Versickerungsflächen und -volumina sind auf ein Regenereignis mit Wiederkehrperiode von 10 Jahren (Jährlichkeit Z10) zu dimensionieren. Ist dies aus nachweislichen Gründen nicht möglich, können geringere Jährlichkeiten, z.B. Z1, Z2 oder Z5, als Basis gewählt werden. Dies hat bereits einen signifikanten Effekt auf die jährliche Wasserbilanz.
Die Einplanung eines Notüberlaufs für Extremereignisse ist in jedem Fall vorzusehen. Ausgehend vom maximal vorgesehenen Wasserspiegel ist die Überfallkote des Überlaufs zu berechnen.
Begrünung und Vegetation
Im Folgenden werden Grundsätze zur Planung und Realisierung für eine möglichst naturnahe Begrünung von Schwammstadt-Elementen formuliert. Für weiterführende Informationen sei insbesondere auf das Fachthema Naturnahe Pflanzenverwendung auf fokus-n verwiesen.
- Substrat (Aufbau, Typ, Dimension) und Vegetation aufeinander abstimmen
- Baumstandorte mit (überbaubarem) Substrat für eine optimierte Nährstoff-, Luft- und Wasserversorgung versehen
- Artenreiche, möglichst einheimische sowie standortgerechte und klimaangepasste Begrünungen anstreben. Möglichst regionales Saat- und Pflanzgut aus lokalen Quellen beziehen
- Bei Pflanzenwahl Einstautiefe des Wassers, klimatische und andere Standortbedingungen sowie künftige Veränderungen berücksichtigen
- Früh austreibende (inkl. Geophyten) und salztolerante Pflanzenarten auswählen – je nach Nutzung der angeschlossenen Flächen
- Keine invasiven gebietsfremden Pflanzen verwenden
- Für Standort und anvisiertes Zielbild ideale Begrünungsmethode festlegen
- Standort vor Begrünung optimal auf Pflanzen vorbereiten
- Umweltschonende Maschinen, Geräte und Hilfsmittel einsetzen
- Pflanzenschutz und Qualitätskontrolle im Rahmen der Lieferung gewährleisten
- Wo möglich und sinnvoll Kleinstrukturen (Steine, Holz) vorsehen
- Langfristige Entwicklung und Pflege frühzeitig berücksichtigen; Erstellungspflege an Begrünungsart anpassen
Pflege
Grundsätze
Die Pflege erfolgt fachgerecht, dem Standort, der Nutzung und der Vegetation angepasst sowie biodiversitätsfördernd. Für weiterführende Informationen sei insbesondere auf das Fachthema Naturnahe Pflege bei fokus-n verwiesen.
Folgende übergeordneten Grundsätze gelten für die Pflege (Erhaltungspflege) von begrünten Schwammstadt-Elementen:
- Pflege auf Standortbedingungen abstimmen
- Verkehrssicherheit zu jedem Zeitpunkt sicherstellen
- Pflanzenrückschnitt erfolgt vegetationsangepasst, abschnittsweise und möglichst nach der Samenreife wertvoller Pflanzenarten; Säume und Blumeninseln stehen lassen
- Spontanvegetation zulassen und fördern
- Problempflanzen – insbesondere invasive gebietsfremde Pflanzenarten – selektiv und frühzeitig bekämpfen und fachgerecht entsorgen
- Falls Bewässerung nötig, erfolgt diese bedarfsgerecht und wassersparend
- Laub nur dort entfernen, wo nötig
- Bodendurchlässigkeit mittels Laubmanagement, Mulch und bodenschonendem Unterhalt fördern und gegebenenfalls mittels Bodenlockerung oder Nutzungseinschränkungen verbessern
- Bio-konforme Düngung und Pflanzenschutz nutzen sowie aktive Nützlingsförderung betreiben
- Verzicht auf den Einsatz von Herbiziden und Pestiziden
- Grünflächen nicht zum Deponieren von Schnee und nicht zum Abstellen von Fahrzeugen nutzen
- Entsorgung von belastetem Schnittgut im Unterhaltkonzept definieren. Schnittmaterial von belasteten Versickerungsflächen muss in einer KVA verbrannt werden.
- Entfernung von Sedimenten, Müll und sonstigen Ablagerungen regelmässig und insbesondere nach Überflutungsereignissen vornehmen
- Maschinen tier- und ressourcenschonend einsetzen
- Kontrolle und Wartung regelmässig und insbesondere nach Überflutungsereignissen vornehmen und gegebenenfalls Massnahmen ergreifen
- Fachgerechte Pflege langfristig gewährleisten sowie hierfür notwendige Kompetenzen und Ressourcen sichern
Winterdienst
Aufgrund des Winterdienstes fallen Salzfrachten an, welche es bei der Planung zu berücksichtigen gilt. Lösungen sind an der Quelle zu suchen (Reduktion der Salzfracht) sowie beim Schutz der Pflanzenstandorte vor negativen Einflüssen der Tausalze:
Reduktion des Salzeintrags, z.B. differenzierte Austragung von Tausalz je nach Strassentyp/Nutzung
Verwendung alternativer Enteisungsmassnahmen (z.B. Verwendung von Splitt, Kies)
Einleitung des Strassenabwassers zwischen die Baumstandorte (nicht direkt an Stamm/im Bereich der Baumscheibe)
Pflanzung salztoleranter Arten
Gezielte Auswaschung der Tausalze im Frühjahr (vor Vegetationsperiode), falls keine natürlichen Starkregen stattfinden
Schneeablagerungen auf Begrünungen und Baumscheiben vermeiden
Herausforderungen Winterdienst
Quelle: Toolbox Schwammstadt Stadt Schaffhausen
Schwammstadt Schaffhausen
Potenzialstudie Schwammstadt
Durch die Klimaveränderung nehmen Starkniederschläge, Hitzewellen und Trockenperioden in unseren Breitengraden zu. Dies ist nicht nur Stand der Wissenschaft, sondern können wir in der Schweiz und Europa jährlich selber beobachten. In Kombination mit versiegelten Flächen führt dies in Siedlungsgebieten zur Überlastung des Entwässerungssystem. Zudem bleibt die Ressource Niederschlagswasser nach bisherigem Stand der Technik grösstenteils ungenutzt. Um diesen Voraussetzungen entgegenzuwirken, kommt vermehrt das Thema Schwammstadt zum Zuge.
Die Stadt Schaffhausen hat sich im Rahmen ihrer Klimastrategie dazu verpflichtet, das Thema Stadtklima zu optimieren. In diesem Zusammenhang sollen in zukünftigen Hoch-, Tief- und Freiraumprojekten die Massnahmen nach dem Schwammstadtprinzip ausgeführt werden.
Im nachfolgenden Bericht werden die in der Stadt Schaffhausen angewendeten Instrumente für Schwammstadtmassnahmen sowie das Vorgehen für die Ermittlung des Potenzials pro Parzelle definiert und beschrieben.
Potenzialkarte
Für die Ermittlung des effektiven Schwammstadtpotenzials wird aus verschiedenen Parametern eine Defizit- sowie Eignungsanalyse erstellt. Aus der Kombination dieser beiden Bausteine resultiert eine Potenzialkarte, welche parzellengetreu Angaben zum effektiven Defizit, Eignung und Potenzial ausweist. Zusätzlich beinhaltet sie Vorschläge zu möglichen Massnahmen.
Die Potenzialkarte wird künftig im Geoportal der Stadt Schaffhausen aufgeschaltet.
Toolbox
Um Planende und Bauherrschaften optimal bei der Planung und Realisierung von Schwammstadtmassnahmen unterstützen zu können, wurde die Toolbox entwickelt. Die einzelnen Bausteine sind hier mit wichtigen Infos und Hinweisen aufgeführt sowie zu verwandten Themenfeldern auf fokus-n verlinkt .
Pilotprojekt Kreuzgut
Das Pilotprojekt Kreuzgut zeigt beispielhaft, wie Schwammstadt-Elemente klimaangepasst, biodivers und standortgerecht umgesetzt werden können. Im Zuge der Sanierung und Erweiterung des 1954 erbauten Schulhauses Kreuzgut im Schaffhauser Quartier Herblingen wurden verschiedene Massnahmen geplant, realisiert und getestet. Ziel ist es, Regenwasser lokal zu versickern, zurückzuhalten und pflanzenverfügbar zu machen.
Finanziell unterstützt wird das Schwammstadt-Projekt durch Fördermittel und Beiträge aus den Überschussfonds der Mobiliar Genossenschaft. Für das Projekt beim Schulhaus Kreuzgut stellt sie CHF 110'000 bereit – für bauliche Massnahmen, die Wirkungskontrolle und die Erstellung von Informationsmaterial, um das gewonnene Wissen verschiedenen Zielgruppen zugänglich zu machen und zu vermitteln. Weiter wird das Projekt von der Smart-City-Stelle der Stadt Schafhausen mit einem Rahmenkredit von CHF 40'000 unterstützt.
Biodiverses Schwammstadt-Element, Schulhaus Kreuzgut, Schaffhausen
Quelle: Grün Schaffhausen
Dokumentation Planungs- und Bauprozess
Die Dokumentation beleuchtet den Prozess der Neugestaltung des Aussenraums des Schulhauses Kreuzgut. Sie zeigt auf, wie interdisziplinäre Zusammenarbeit, frühzeitige Zieldefinitionen und gut durchdachte Lösungen die wirksame Umsetzung der Schwammstadt-Prinzipien ermöglichen.
Forschungsbox Schwammstadt
In Zusammenarbeit mit Lehrpersonen der Primarschule Kreuzgut Schaffhausen, Grün Schaffhausen und mit der finanziellen Unterstützung der Mobiliar Genossenschaft hat die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften die «Forschungsbox Schwammstadt» entwickelt und im Juni 2025 in einer Pilotanwendung erprobt.
Die Forschungsbox enthält Lehr- und Lernmaterial und notwendige Messgeräte und Materialien. In der Dokumentation sind Inhalt und Pilotanwendung der Forschungsbox beschrieben.
Weitere Informationen
- Weiterführende Informationen zum Regenwassermanagement: Fachthema Regenwassermanagement
- Umfangreiche Informationen und Instrumente für ein klimaangepasstes Wassermanagement im Siedlungsgebiet: «Infoplattform Schwammstadt», sponge-city.info
- Informationen zu Grün Schaffhausen, Abteilung Planung, Naturschutz, Administration: Grün Schaffhausen
Bestimmungen
Quellen
VSA, Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter, 2019.
VSS, Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute, 640 354 -
Entwässerung über das Bankett, 2010.
VSS, Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute, SN 640 361 -
Behandlungsanlagen SABA, 2017.